Auf dieser Seite liste ich eine Auswahl von Büchern auf, die ich gelesen habe und die ich für lesenswert erachte. Die Auswahl ist absolut subjektiv und spiegelt eben meine eigenen Interessen wieder. Vielleicht ist dennoch etwas für Sie dabei!
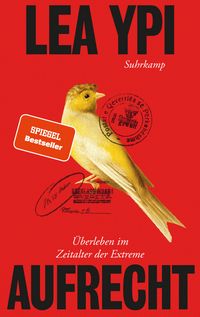 Lea Ypi: Aufrecht Überleben im Zeitalter der Extreme
Lea Ypi: Aufrecht Überleben im Zeitalter der ExtremeDas Buch wurde in der Wochenendausgabe der taz besprochen. Als die Autorin ein Bild in die Finger bekam, welches ihre Großeltern 1941, mitten im 2. Weltkrieg, beim Après-Ski in den italienischen Alpen zeigt, fragte sie sich, was sie wirklich über das Leben ihrer Großeltern weiß. Lea Ypi rekonstruierte aus Archivfunden und Familienerinnerungen das Leben ihrer Großmutter – zwischen dem Osmanischen Reich und dem sozialistischen Albanien. Beim Lesen wurde mir klar, wie wenig ich über die Verwerfungen und Schicksalsschläge wusste, denen die Menschen im vergangenen Jahrhundert dort ausgesetzt waren.
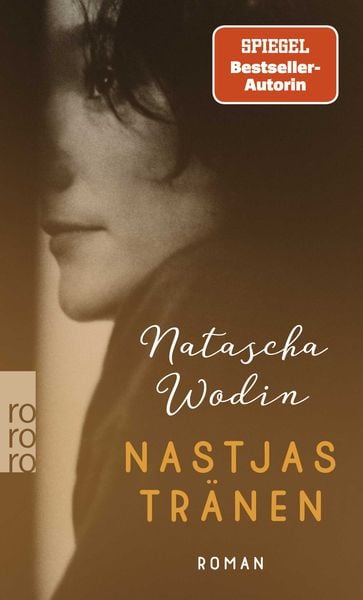 Natscha Wodin: Nastjas Tränen
Natscha Wodin: Nastjas TränenAls Natascha Wodin nach Berlin kam, suchte sie eine Putzfrau. Wie das so ist, wenn sich Mehrere um die Stelle bewerben, irgendwann weiß man nicht mehr, wen man nehmen soll. So ging es auch Natascha Wodin und sie beschloss die Nächste zu nehmen, die sich meldet.
Gesagt getan. Die nächste, die sich meldete, war Nastja, eine Frau aus der Ukraine, dem Herkunftsland von Natascha Wodins Mutter. Dass die Frau mit einem Touristenvisum nach Deutschland gekommen war, wusste Frau Wodin nicht. Irgendwann war das Visum abgelaufen und Nastja berichtete in ihrer Not Natascha Wodin davon. — Wie es dann weitergeht, verrate ich hier nicht. Jedenfalls haben wir es hier mit einem einzigartigen Stück Literatur zu tun: Ein deutschsprachiges Buch, welches das Leben einer Ukrainerin in Deutschland schildert, gibt es sonst nicht.
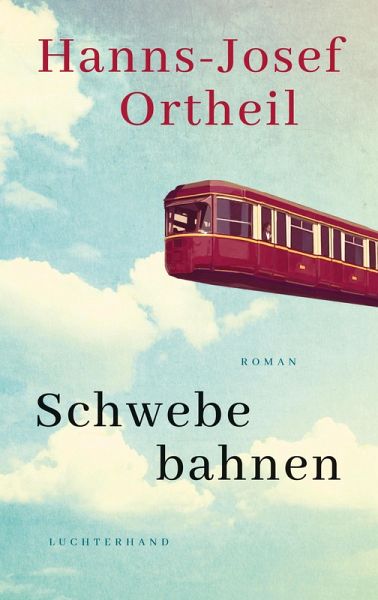 Hanns-Josef Ortheil: Schwebebahnen
Hanns-Josef Ortheil: SchwebebahnenIn der ersten Klasse in der Grundschule in Köln war Josef überfordert. Nicht so sehr vom Lernstoff, Lesen und Schreiben kann er schon, das hat ihm der Vater beigebracht. Auch spielt er sehr gut Klavier. Er übt gerne — bis zu 4 Stunden täglich. Er war aber sehr unsicher im Kontakt mit seinen Klassenkameraden. Die spürten das und so war er dort der gehänselte Außenseiter.
Mit dem Umzug der Familie nach Wuppertal tat sich für ihn auf einmal eine neue Welt auf. Er begegnete dort Mücke, der Tochter des Gemüsehändlers von nebenan. Gemeinsam finden sie ihren Weg ins Leben in der Stadt der Schwebebahnen.
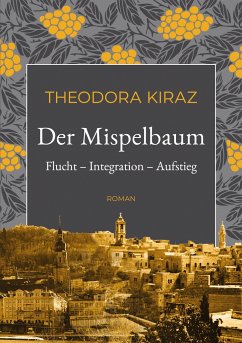 Theodora Kiraz: Der Mispelbaum Flucht Integration Aufstieg
Theodora Kiraz: Der Mispelbaum Flucht Integration AufstiegIch hatte das Privileg die Autorin während meines Medizinstudiums in Heidelberg kennenzulernen. Wir waren im selben Semester. Theodora hat mir damals ein differenziertes Bild der arabischen Bevölkerung in Palästina vermittelt. Bis dahin hatte ich eine, vorsichtig ausgedrückt, eher vorurteilsgeprägte Vorstellung von den Arabern in Palästina. Ich habe damals begriffen, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Araber dort von Herkunft, Religion und sozialer Prägung eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe waren und sind.
Dabei hat mich ihre Haltung beeindruckt. Obwohl es, so wie sie mir ihre Geschichte und die ihrer Familie schilderte, hinreichend Gründe gegeben hätte gegenüber den Juden Hass zu empfinden, urteilte sie differenziert und mit Empathie für die Anderen.
Ich kann das Buch nur empfehlen.
_schoen_war_die_Zeit.jpg) Walter Langohr: So schön, schön war die Zeit Als der Traktor noch ein Bulldog war
Walter Langohr: So schön, schön war die Zeit Als der Traktor noch ein Bulldog warDie 50er-Jahre-Version des Ford Taunus auf dem Cover des Buches hatte mein Interesse geweckt. In der Buchhandlung Volk in Buchen im Odenwald habe ich das Buch entdeckt. Walter Langohr dürfte ca. 15 Jahre älter sein als ich. Er schildert eine Kindheit und Jugend auf dem Land, so wie ich sie als Stadtkind nie erleben durfte. Es geht in dem Buch auch darum, wie die Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten in der Dorfgemeinschaft ihren Platz fanden. In meiner schwäbischen Heimat hieß es noch in den Siebziger-Jahren über manche Leute "Des isch a Flichtleng". Und es waren, so wie in dem Buch, oft die Kinder, die über Herkunftsgrenzen schneller zueinander fanden als die Erwachsenen.
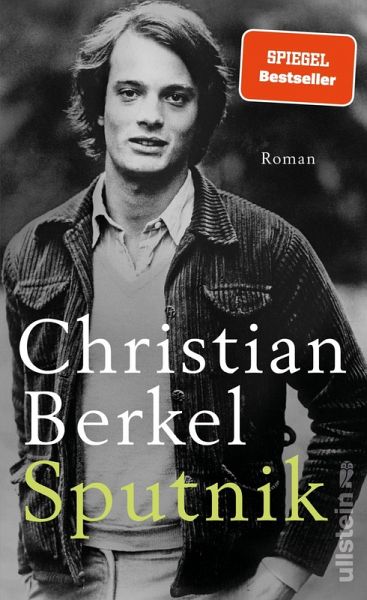 Christian Berkel: Sputnik
Christian Berkel: SputnikNachdem Christian Berkel in dem Buch Der Apfelbaum die Geschichte seiner Eltern erzählt hat, geht es in diesem Roman um seine Kindheit und Jugend. Christian Berkel verlebte einen Teil seiner Jugend in Paris. Dank seiner französisch sprechenden Mutter sprach er die Sprache akzentfrei, was ihm in der Nachkriegszeit in Paris manches leichter machte. Allerdings war sein Weg in die Schauspielerei auch dort mit Hindernissen gepflastert.
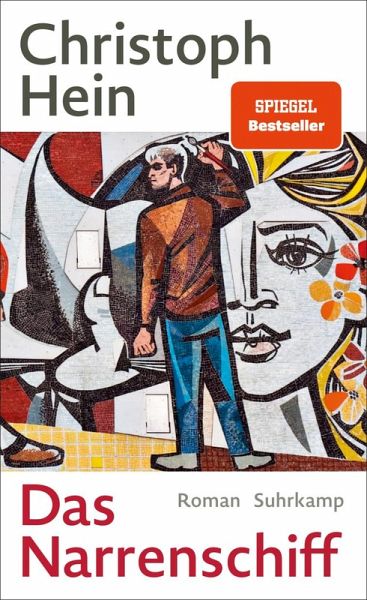 Christoph Hein: Das Narrenschiff
Christoph Hein: Das NarrenschiffSchon wieder ein DDR-Buch: Christoph Heins Buch wird so beworben: »Eine epische Erzählung der DDR und ihrer Bürgerinnen und Bürger - von der Staatsgründung bis zum Mauerfall« Ich kann's nur empfehlen. Vieles, was in dem Buch erzählt wird, wusste ich noch nicht. Mich hat besonders beeindruckt, dass es eben nicht nur ein Geschichtsbuch ist, sondern ein Geschichtenbuch. In vielen Geschichten wird erzählt, was die Zeit mit den Menschen gemacht hat und wie sie (re-)agierten.
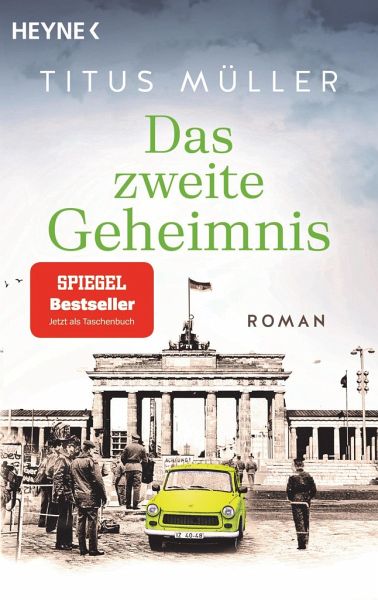 Titus Müller: Das zweite Geheimnis
Titus Müller: Das zweite GeheimnisDa habe ich also schon wieder ein Buch über die Zeit der deutschen Teilung in zwei deutsche Staaten gekauft. Das Thema lässt mich offenbar nicht los. In dem Buch kommt die Ost-West-Geschichte vor, wie sie während meiner Kindheit und Jugend stattfand: Angefangen von den Jugendfestspielen in Ostberlin über die Fluchtversuche aus der DDR (auch von Grenzsoldaten), von Alexander Schalck-Golodkowski bis hin zu Willy Brandt, seiner Frau Rut und der Guillaume-Affäre. Alles drin und spannend erzählt, so dass ich gar nicht bemerkt habe, dass es der zweite Band einer Trilogie ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt, nur weil ich die beiden anderen Bände noch nicht gelesen habe.
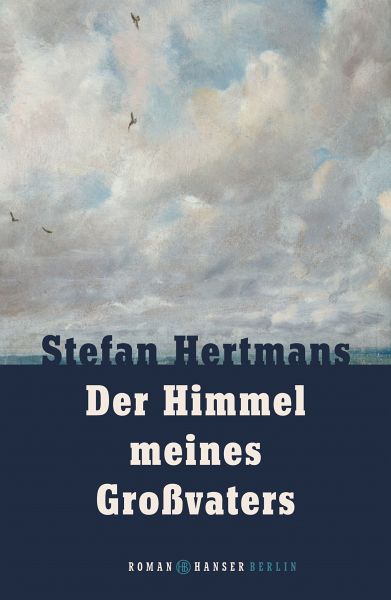 Stefan Hertmans: Der Himmel meines Großvaters
Stefan Hertmans: Der Himmel meines GroßvatersWieder einmal ein Buch, welches es nur noch als Ebook zu kaufen gibt.
„Man kann alles, wenn man will”, sagt der alte Mann zu seinem Enkel und schwingt sich in den Kopfstand. Die wahre Willenskraft seines Großvaters begreift Stefan Hertmans jedoch erst, als er dessen Notizbücher liest, und beschließt, den Roman dieses Lebens zu schreiben. Mit 13 beschließt der Großvater des Autors Künstler zu werden, wie sein Vater. Bevor er sich als ein solcher etablieren kann, kommt erst einmal der erste Weltkrieg dazwischen. Indem Stefan Hertmans Szenen aus dem Leben der beiden schildert, gelingt es dem Autor das ganze Jahrhundert samt den gesellschaftlichen Brüchen zu schildern. Das macht das Buch so interessant.
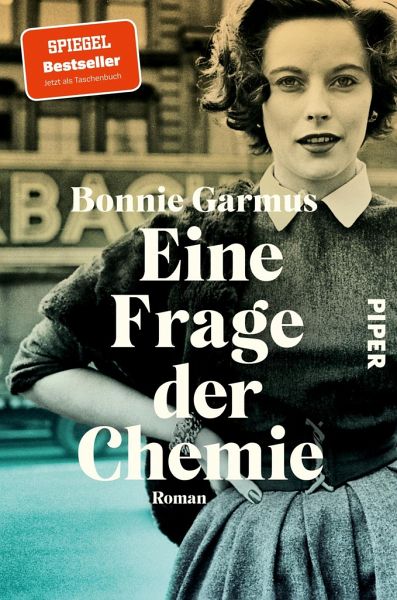 Bonnie Garmus: Eine Frage der Chemie
Bonnie Garmus: Eine Frage der ChemieEs ist das Erstlingswerk einer in Kalifornien geborenen Autorin, die heute in London lebt.
„Elizabeth Zott” das ist der Name der Romanheldin. Sie wurde allen Widerständen ihrer Zeit zum Trotz Chemikerin und möchte als Wissenschaftlerin arbeiten und anerkannt werden. Wie schwer das war, oder ist?, zeigt dieser Roman. Als Elisabeth Zott ihre Stelle im Labor verliert, baut sie zu Hause ihre Küche in ein Forschungslabor um. Da forscht sie weiter. Trotz der geschilderten krassen Widerstände findet die Romanheldin ihren Weg. Sie versucht auch ihrer Tochter mit Ratschlägen zu helfen, so dass dieser nicht dasselbe widerfahren würde. Das Buch bleibt trotz des schwierigen Themas bis zum Schluss spannend. Auf keinen Fall lesen!
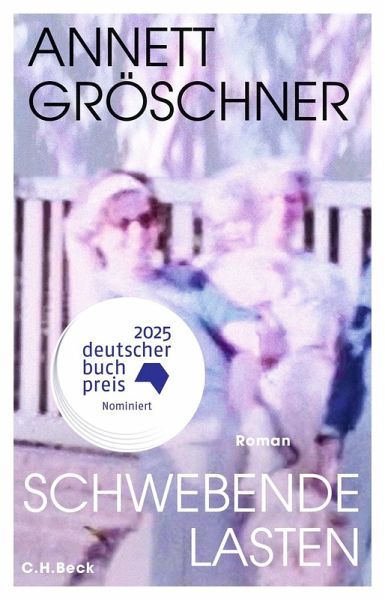 Annett Gröscher: Schwebende Lasten
Annett Gröscher: Schwebende LastenDieses Buch habe ich von meiner Frau erhalten.
Es handelt von der 1913 geborenen Hanna Krause, einer Frau aus dem Arbeitermilieu. Hanna Krause lebte in Magdeburg und war zuerst Blumenbinderin und Blumenverkäuferín mit eigenem Blumenladen. Nach dem 2. Weltkrieg wurde sie zur Kranfahrerin umgeschult.
Das Buch hat seine Stärken dadurch, dass die Lebensbedingungen von ihrer Kindheit bis zu ihrem Lebensende aus ihrer Perspektive geschildert werden. So gibt das Buch beides wieder: Die Schrecken der Zeiten, wo wir wieder einmal erkennen können, wie gut es uns erging und noch ergeht. Und ... die Geschichte einer tapferen Frau, die es in ihrem Leben nicht einfach hatte und deren Lebensleistung Respekt abnötigt.
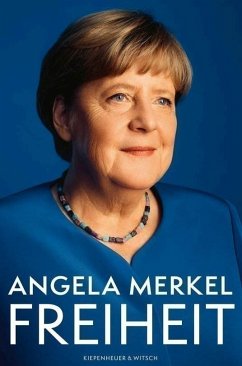 Angela Merkel: Freiheit
Angela Merkel: FreiheitWenn ich das Buch lese, egal an welcher Stelle, stellt sich das Gefühl ein »boah ohh! Ich hätte nie gedacht, dass Regieren sooo anstrengend sein kann!«
Wenn in Deutschland sich derzeit viele Mitbürger nicht richtig mit ihren Interessen vertreten fühlen, so sollten sie dieses Buch lesen, bevor sie sich beschwehren. Mir ist jedenfalls beim Lesen noch einmal klar geworden, wie schwer es ist, in einer multipolaren Welt verbindliche Regeln zu etablieren, die wirklich langfristig zielführend sind, sei es beim Thema Wirtschaft, Finanzen, Umwelt, Klimaschutz oder beim Kampf gegen Hunger und Ausbeutung.
Das Buch nötigt mir höchsten Respekt vor der Leistung Angela Merkels ab. Wenn das ihr Ziel mit dem Buch war, so ist ihr das gelungen!
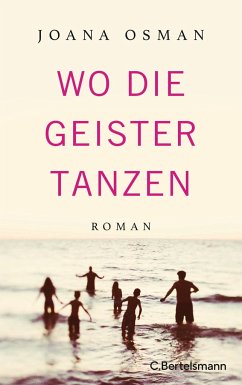 Joana Osman: Wo die Geister tanzen
Joana Osman: Wo die Geister tanzenDie Autorin rekonstruierte anhand weniger Tagebücher die Geschichte ihrer Großeltern, die 1948 wie tausende andere arabische Familien aus dem britischen Mandatsgebiet (in dem Fall aus Jaffa) vertrieben worden waren. Die Flucht geht über den Libanon in die Türkei und wieder zurück in den Libanon. Das Buch ist eine Mischung von Fiktion und Autofiktion. Die Autorin lässt darin auf virtuose Weise die Geister der Vergangenheit tanzen.
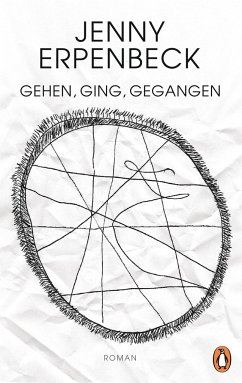 Jenny Erpenbeck: Gehen, Ging, Gegangen
Jenny Erpenbeck: Gehen, Ging, GegangenIch zitiere aus der Besprechung des Buches auf www.buecher.de: »Richard, emeritierter Professor, kommt durch die zufällige Begegnung mit den Asylsuchenden auf dem Oranienplatz auf die Idee, die Antworten auf seine Fragen dort zu suchen, wo sonst niemand sie sucht: bei jenen jungen Flüchtlingen aus Afrika, die in Berlin gestrandet und seit Jahren zum Warten verurteilt sind.«.
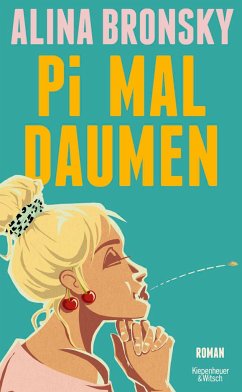 Alina Bronsky: Pi mal Daumen
Alina Bronsky: Pi mal DaumenEine 53-jährige Lippenstift-affine Oma, immer bunt gekleidet und mit hohen Absätzen versorgt, beschließt, zusätzlich zu ihren drei Nebenjobs, etwas zu machen, was sie bisher in ihrem Leben unterlassen hat → Sie beschließt Mathemathik zu studieren.
Da sie hinsichtlich Alter, Geschlecht, Styling, innerer Haltung und bisheriger Lebensplanung unter den Studierenden eine Außenseiterin ist, bekommt sie erst einmal Kontakt zu einem weiteren Außenseiter unter den Studenten, dem 16-jährigen hochbegabten Oscar, dem Ich-Erzähler. Der Kennenlerndialog verläuft folgendermaßen (ich zitiere):
»Oscar« sagte ich, als sie die Nummer eingetippt hatte und mich fragend ansah.
»Und weiter ?«
»Oscar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorff.« Ich buchstabierte.
»Hilfe«, sagte Moni. »Ist es okay, wenn ich keinen Knicks mache?«
»Und weiter ?«
»Oscar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorff.« Ich buchstabierte.
»Hilfe«, sagte Moni. »Ist es okay, wenn ich keinen Knicks mache?«
In dem Stil geht es weiter. Ein wunderbares Buch, welches mit lakonischer Sprache, die Geschichte erzählt. — Ich werde es meiner Tochter schenken, welche gerade Psychologie studiert.
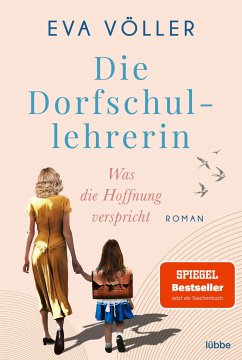 Eva Völler: Die Dorfschullehrerin Was die Hoffnung verspricht (Band 1)
Eva Völler: Die Dorfschullehrerin Was die Hoffnung verspricht (Band 1)Der Roman spielt im Jahr 1961. Er schildert das Schicksal einer jungen Grundschullehrerin aus Ost-Berlin, die vor dem Bau der Berliner Mauer zusammen mit Ehemann und Tochter in den Westen fliehen wollte. Die Flucht wird von der Stasi verhindert.
Der Ehemann kommt in der Haft um. Dank befreundeter Stasi-Mitarbeiter kann die junge Frau nach einiger Zeit in der Haft doch noch in den Westen übersiedeln. Die Tochter wird aus dem Kinderheim entlassen und kommt in die Obhut der bei der Stasi als zuverlässig geltenden Großeltern, die nahe der Grenze zu Hessen in der Rhön wohnen.
Sowohl im Osten als auch im Westen herrschte zu der Zeit Lehrermangel. Die junge Frau wird Lehrerin in der Dorfschule in dem Dorf in Hessen, welches wenige Kilometer westlich des Wohnortes der Eltern und der Tochter liegt. Sie hofft, ihre Tochter in den Westen holen zu können.
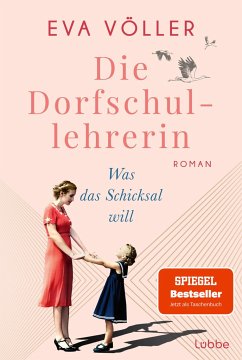 Eva Völler: Die Dorfschullehrerin Was das Schicksal will (Band 2)
Eva Völler: Die Dorfschullehrerin Was das Schicksal will (Band 2)Der zweite Teil spielt im Jahr 1964. Die Tochter und die Eltern der Lehrerin haben nach einer spektakulären Flucht den Westen erreicht. Damit ist das Hauptziel der Lehrerin erst einmal erreicht. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie geht das Leben weiter? Ihren Freund den Arzt des Dorfes kann sie nicht einfach heiraten, dann wäre ihre Stelle als Lehrerin futsch. So war die Zeit damals!
Der zweite Teil ist nicht weniger spannend als der Erste, denn jetzt zeigt sich, wie schwierig es ist, die eigenen Werte zu leben.
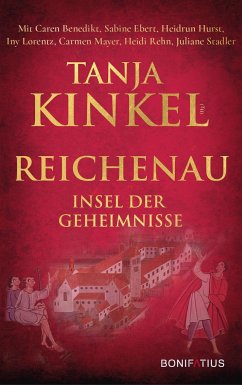 Tanja Kinkel: Reichenau - Insel der Geheimnisse
Tanja Kinkel: Reichenau - Insel der Geheimnisse2024 ist es 1300 Jahre her, dass der der Wandermönch und spätere Abt Pirmin das Kloster gegründet hatte. Acht Autorinnen historischer Romane haben sich zusammengefunden um zu den verschiedenen Zeitabschnitten von 724 bis 1541 jeweils eine historische Kurzgeschichte zu schreiben. Einerseits Fiktion, aber diese ist orientiert an den historischen Begebenheiten und vermittelt Wissenswertes über die Geschichte der Reichenau.
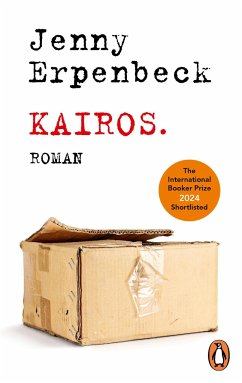 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: KairosDie neunzehnjährige Katharina und Hans, ein verheirateter Narzist, Mitte fünfzig, begegnen sich Ende der achtziger Jahre in Ostberlin, zufällig, und verlieben sich in einander. Die „Liebesgeschichte” finde ich, positiv gesagt, unerheblich. Spannend finde ich das im Buch beschriebene gesellschaftliche Wertesystem und das Denken der Menschen in den letzten Jahren der DDR.
 Klaus Kordon: Die Einbahnstraße ← Ich komme von Klaus Kordon nicht los. Nachdem ich Paule Glück Das Jahrhundert in Geschichten, Die Zeit ist kaputt Die Lebensgeschichte des Erich Kästner, 1848 Die Geschichte von Jette und Frieder, Fünf Finger hat die Hand, Im Spinnennetz und Julians Bruder gelesen habe, fiel mir nun beim Besuch von Freunden dieses Jugendbuch in die Finger. Es ist ein wunderbares Buch, welches geeignet ist, Jugendliche über die Gefahren des Drogenkonsums aufzuklären:
Klaus Kordon: Die Einbahnstraße ← Ich komme von Klaus Kordon nicht los. Nachdem ich Paule Glück Das Jahrhundert in Geschichten, Die Zeit ist kaputt Die Lebensgeschichte des Erich Kästner, 1848 Die Geschichte von Jette und Frieder, Fünf Finger hat die Hand, Im Spinnennetz und Julians Bruder gelesen habe, fiel mir nun beim Besuch von Freunden dieses Jugendbuch in die Finger. Es ist ein wunderbares Buch, welches geeignet ist, Jugendliche über die Gefahren des Drogenkonsums aufzuklären:Andy ist von Inga fasziniert. Auch als sich herausstellt, dass sie drogensüchtig ist, weicht er nicht von ihrer Seite. Er haut mit ihr ab, taucht in einer WG unter. Die Frage, die sich in dem Buch stellt ist: Gibt es einen Weg zurück aus dem Strudel der Abhängigkeit oder ist es eine Einbahnstraße?
 ← Buchtitelbild © booklooker
← Buchtitelbild © booklookerJ.L. Talmon: Die Ursprünge der totalitären Demokratie
Im Urlaub bin ich im Museumscafe der Insel Reichenau auf dieses Buch gestoßen. Das Café ist nicht nur ein Café — es ist eine Bücherstube, in der man Bücher entdecken und sogar ausleihen kann. Man darf auch Bücher mitbringen. Jedes Jahr entdecken wir in dem Café etwas Neues.
Das Buch kam mir vor, wie aus der Zeit gefallen. Erstmals publiziert auf Englisch im Jahr 1952, ist es in deutscher Übersetzung zum Beginn des Jahres 1961, also noch vor dem Bau der Berliner Mauer, erschienen. Der Autor, der in Polen als Sohn einer orthodoxen jüdischen Familie geborene Jacob Leib Talmon (* 14. 06. 1916 — † 16. 06. 1980) war zum Erscheinungszeitpunkt Professor für Moderne Geschichte an der Hebräischen Universität von Jerusalem.
Das Buch versucht zu zeigen, dass sich im achtzehnten Jahrhundert - gleichzeitig mit einem „liberalen Typ der Demokratie” und aus denselben Prämissen heraus - eine Tendenz in Richtung auf das anbahnte, was wir als „totalitären Typ der Demokratie” bezeichnen könnten. Beide Strömungen haben seit dieser Zeit ohne Unterbrechung nebeneinander bestanden. Die Spannung zwischen ihnen bildet ein wichtiges Kapitel in der neueren Geschichte. Denken wir an Ungarn oder auch an Polen, so ist die Frage nach der Qualität der Demokratie auch nach dem Untergang der DDR zu einer der entscheidenden Kernfragen unserer Zeit geworden. Natürlich beschäftigt sich das Buch auch mit Detailfragen, die wir heute als weniger relevant oder sogar belanglos einstufen. Von heute aus gesehen - erscheint in der Tat die Geschichte der letzten hundertfünfzig Jahre als ein Weg zwischen „liberaler Demokratie” einerseits und „totalitärer Demokratie” andererseits - eine der fortbestehenden Weltkrisen von heute.
↵ Der Klick auf den Hintergrund führt zur Website der Insel Reichenau, wo es um das Mvseumscafe geht.
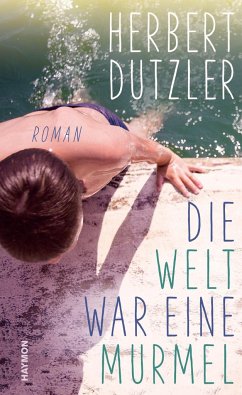 Herbert Dutzler: Die Welt war eine Murmel
Herbert Dutzler: Die Welt war eine MurmelDie Geschichte spielt 1968 und wird aus der Perspektive des zehnjährigen Siegfried Niedermayr erzählt, der mit seiner Familie, das heißt mit der Mutter Edeltraud, dem Vater Adolf und jüngeren Schwester Uschi, mit dem Reisebus (ein Auto hat die Familie nicht) für eine Woche nach Italien ans Meer fährt.
Im Vorjahr war ein Klassenkamerad der Einzige in der Klasse, der damit angeben konnte, in den Ferien in Italien am Meer gewesen zu sein. Er wurde dafür von allen Anderen beneidet. Siegfried packte seine Winnetou-Bücher ein und freute sich schon darauf nach den Ferien auch zum erlesenen Kreis der beneideten Italienfahrer zu gehören.
Es sind die Details, die dafür sorgen, dass der Roman für mich, der in den Sechziger-Jahren Kind war, noch einmal der Blick in die alte Welt öffnet, in der es klar war, dass eine Mutter sich um den Haushalt und um die Kindererziehung zu kümmern hatte, der Mann das Geld nach Hause brachte und in der es nur einem privilegierten, kleinen Teil der Kinder, so wie Siegfried, vergönnt war nach den großen Ferien ins Gymnasium zu gehen, um später einmal „etwas Gescheites” zu werden. Seine Mutter Edeltraud wollte, dass er aufs Gymnasium geht, ... der Vater Adolf war eher dafür, dass er auf die Hauptschule geht und dann in der Lehre „etwas Gescheites” lernt.
Um das klarzustellen: Meine Eltern waren weit weniger „Sechziger” als die Eltern von Siegfried. Da bin ich ihnen heute noch dankbar dafür.
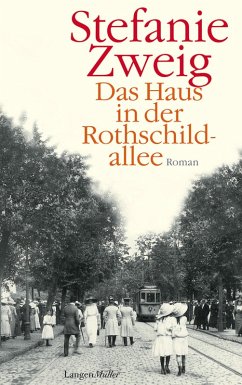
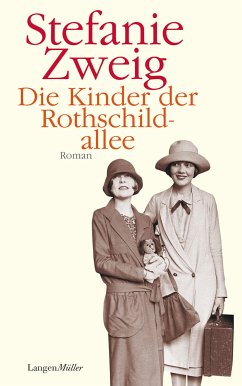
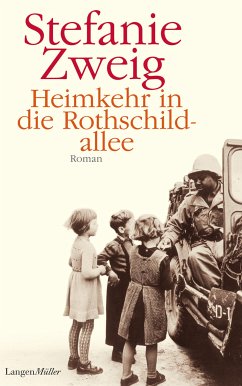
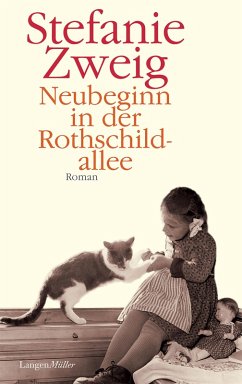 Stefanie Zweig: Das Haus in der Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.1
Stefanie Zweig: Das Haus in der Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.1Stefanie Zweig: Die Kinder der Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.2
Stefanie Zweig: Heimkehr in die Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.3
Stefanie Zweig: Neubeginn in der Rothschildallee / Rothschildsaga Bd.4
Ich lese gerade den ersten Band, den ich mir aus der Stadtbücherei ausgeliehen habe. Zu kaufen gibt's das Buch nur noch als EBook.
Es beginnt zur Jahrhundertwende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert: Johann Isidor Sternberg, ein erfolgreicher jüdischer Tuchhändler, kaufte sich ein Mehrfamilienhaus in der Rothschildallee 9 in Frankfurt am Main. Als 14 Jahre später in Sarajewo der österreichische Trohnfolger Franz Ferdinand ermordet wurde, rief der deutsche Kaiser „alle deutschen Söhne” in den Krieg. Dem Juden Johann Isidor Sternberg standen die Tränen in den Augen. Endlich gehörten die Juden auch dazu und durften dem deutschen Vaterland im Kriege dienen! Als sein Erstgeborener Sohn mit 18 Jahren zum deutschen Heer einberufen wurde, war der Mann stolz. Und — dann gehört dieser Sohn zu den ersten Gefallenen des Jahres 1914.
Der Roman schildert das Leben dieser gutbürgerlichen Familie und die Tragik dieser Zeit.
Die Bände 2 bis 4 habe ich noch nicht gelesen. Die Bände 3 und 4 habe ich mir schon gebraucht besorgt. Fehlt nur noch der Band 2. Sobald ich den habe lese ich weiter.
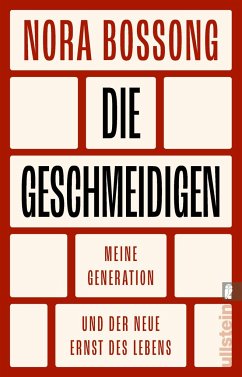 Nora Bossong: Die Geschmeidigen Meine Generation und der neue Ernst des Lebens
Nora Bossong: Die Geschmeidigen Meine Generation und der neue Ernst des LebensEs geht um die Generation der zwischen 1975 und 1985 Geborenen, um die „Geschmeidigen”. Das Buch tat mir gut, weil Nora Bossongs Blick auf unsere aktuelle gesellschaftliche Situation erkennen lässt, dass hier eine Generation am Werke ist, die nicht so schnell aufgibt und sich den Herausforderungen der Zeit stellt.
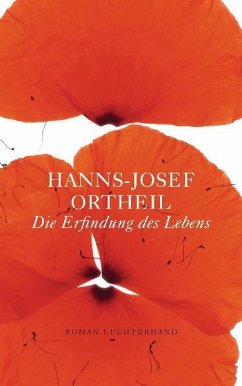 Hanns-Josef Ortheil: Die Erfindung des Lebens
Hanns-Josef Ortheil: Die Erfindung des Lebens»Die Erfindung des Lebens« ist eine autobiographisch inspirierte Geschichte eines jungen Mannes von seinen Kinderjahren bis zu seinen ersten Erfolgen als Schriftsteller. Als einziges überlebendes Kind seiner Eltern, die im zweiten Weltkrieg und der Zeit danach vier Söhne verloren haben, wächst er in Köln auf. Der Kummer hat die Mutter verstummen lassen. Auch er, der letzte verbliebene Sohn, ist als Kind stumm und gewinnt erst mit zunehmender Ich-Stärke seine Sprache wieder. Er schafft den Absprung nach Rom, wo er eine Karriere als Pianist beginnt und nach deren Scheitern mit dem Schreiben sein Glück zu machen versucht.
Der Roman hat mich dadurch fasziniert, dass er aufziegt, wie es Menschen gelingen kann aus völliger Beziehungslosigkeit wieder mit mit Anderen in Kontakt zu kommen.
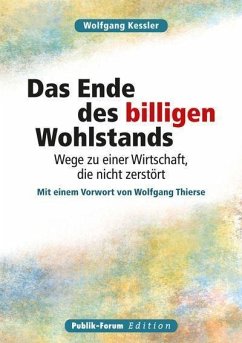 Wolfgang Kessler: Das Ende des billigen Wohlstands Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört
Wolfgang Kessler: Das Ende des billigen Wohlstands Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstörtDer Traum von einer Wirtschaft, die ohne Zerstörung auskommt — Wolfgang Kessler zeigt in dem Buch auf, dass es durchaus Bereiche gibt, wo diese Vision bereits verwirklicht wurde. Und er beschreibt, was sich noch ändern müsste und, wie teuer es wird, damit »die Wirtschaft, die nicht zerstört« keine Utopie bleibt.
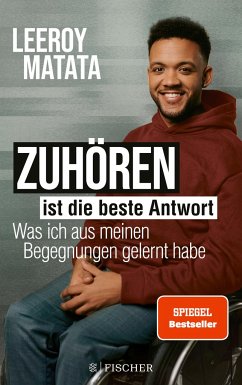 Leeroy Matata: Zuhören ist die beste Antwort Was ich aus meinen Begegnungen gelernt habe
Leeroy Matata: Zuhören ist die beste Antwort Was ich aus meinen Begegnungen gelernt habe»Das Leben ist kein Hollywoodfilm mit märchenhafter Wendung in den Schlussminuten. Aber das sollte uns nicht daran hindern, über die kleinen Fortschritte zu reden, das Gute wahrzunehmen, das passiert ist — ohne das Schlechte zu verschweigen. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass dabei eine unglaubliche Energie bei demjenigen entsteht, der spricht.«
Diese positive Grundhaltung durchzieht das ganze Buch, in dem er seine Erlebnisse aus vielen Gesprächen mit ca. 250 Menschen beschreibt, von denen er auf seinem inzwischen beendeten YouTube-Kanal Videos veröffentlicht hat.
Dabei hätte er selbst durchaus Grund zur Klage: Im Alter von 4 Jahren wird bei ihm eine seltene Erkrankung der Knochen (so dass diese brüchig werden) diagnostiziert. Nicht zuletzt deshalb ist er auf den Rollstuhl angewiesen.
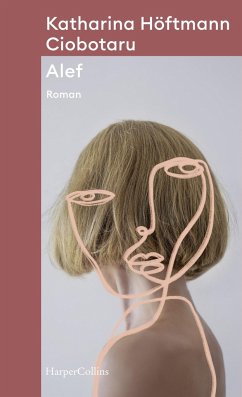 Katharina Höftmann Ciobotaru:Alef
Katharina Höftmann Ciobotaru:AlefIn der Zusammenfassung es Inhaltes des Buches auf buecher.de ist zu lesen: »Alef ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Er steht für Anfang und Ende. Er steht sinnbildlich für die Beziehung zwischen Maja und Eitan. Sie wurde in der DDR geboren und ist im Rostock der 90er-Jahre aufgewachsen - er ist Jude und lebt in Israel. Zwei Welten prallen aufeinander...«
Nach meinem Dafürhalten ist es aber nicht das „Aufeinanderprallen der Welten”, sondern die Verschiedenartigkeit der Menschen die aufeinandertreffen, die das Buch so interessant beschreibt.
Die meisten Menschen können eine Idee formulieren, was aus ihrer Sicht „gut und richtig” ist. Oft machen wir uns nicht klar, dass wir darunter noch die in den meisten Fällen unbewusste Idee davon haben, was gut und richtig ist. Das Buch beschreibt wunderbar, wie diese beiden Ebenen einander in die Quere kommen können. Zum Glück klappt's in dem Buch ganz am Schluss doch, dass die beiden einander (er-)finden.
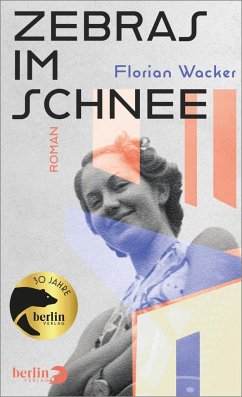 Florian Wacker: Zebras im Schnee
Florian Wacker: Zebras im SchneeDieses Buch ist gerade in Frankfurt total angesagt. Im Augenblick beginnt man sich dort mit der Geschichte der 20er- und frühen 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu beschäftigen. Das war in Frankfurt eine interessante Zeit — Die Stadt wurde gemäß den Bedürfnissen der Zeit neu gestaltet: Es wurde eine Ringstraße um die Frankfurter City gebaut. Eine Straße, die ich immer bewundert habe. Wo man 2-spurig in jeder Richtung rund ums Zentrum fahren kann und wo zwischen den Fahrspuren ein noch breiterer Grüngürtel mit einem oder mehreren Spazierwegen liegt, mit heute wunderbaren, teilweise 100 Jahre alten Bäumen. In dieser Zeit wurden für die Arbeiterschaft viele soziale Wohnbauten errichtet, in denen heute meist die wohlhabenden Frankfurter wohnen1. Es war eine Zeit des Aufbruchs, die anhand einer fiktiven Geschichte in diesem Buch beschrieben wird.
1 Dennoch scheint mir die soziale Durchmischung in Frankfurt am Main besser zu sein als in vielen anderen deutschen Großstädten.
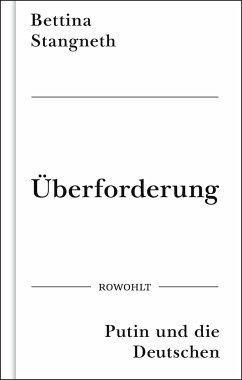 Bettina Stangneth: Überforderung Putin und die Deutschen
Bettina Stangneth: Überforderung Putin und die DeutschenDas Buch reflektiert die „Überforderung” der Deutschen nach dem Angriff Putins auf die Ukraine. Die verbale Reaktion aus Deutschland auf den Angriff Putins auf die Ukraine war ja schon eher eindeutig, aber als es um die Art und Weise ging, wie Deutschland reagieren sollte, ...
- Waffenlieferungen oder nicht?
- Wenn ja, welche Waffen ?
- Wann, wohin?
- Wer rechts eingestellt ist, verurteilt den Angriffskrieg Putins nicht. Indirekt entschuldigen diese Leute Angriffskriege generell und damit auch Hitlers Angriffskriege.
- Wer den Angriffskrieg verurteilt, muss sich umso mehr mit den moralischen Folgen des deutschen Überfalls auf Polen und später auf die Sowjetunion auseinandersetzen und akzeptiert so den Gedanken einer deutschen Kriegsschuld, was die verdrängte Frage wieder ins Bewusstsein rückt, wie wir Deutschen adäquat mit unserer Vergangenheit umgehen sollen. Die Konsequenzen sind dann „Überforderung” und „ängstliches Denken”.
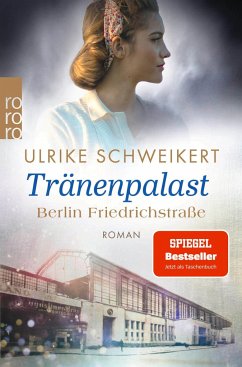 Ulrike Schweikert: Tränenpalast Berlin Friedrichsstraße
Ulrike Schweikert: Tränenpalast Berlin FriedrichsstraßeFriedrichstraßensaga Bd.2
Ich bin versucht zu sagen „ein Frauenbuch”. Das stimmt und es stimmt auch nicht. In erster Linie ist der Roman die Fortsetzung eines früheren Buches von Ulrike Schweikert über vier Freunde, Robert, Johannes, Else und Ella, die in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen aufgewachsen sind. Der zweite Band beschreibt die Zeit vom Ende des zweiten Weltkriegs bis zum Bau der Mauer um West-Berlin, bis zu dem Zeitpunkt, wo aus dem Bahnhof Friedrichstraße das Symbol der Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland geworden ist und zu dem Ort wurde, wo die Abschiedstränen flossen.
Nebenbei ist es die Geschichte eines lesbischen Liebespaares, etwas, was es zu dieser Zeit eigentlich nicht geben durfte.
Ich habe aus dem Buch viel erfahren über die Zeit, als meine Eltern noch Jugendliche und später junge Erwachsene waren.... Gut recherchiert und spannend geschrieben!
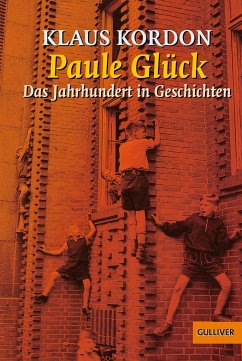 Klaus Kordon: Paule Glück Das Jahrhundert in Geschichten
Klaus Kordon: Paule Glück Das Jahrhundert in GeschichtenWenn es in meiner Kindheit so ein Buch gegeben hätte, dann hätte mich das Fach Geschichte sicher mehr interessiert und ich hätte einen besseren Zugang zu dem Fach gefunden.
In dreizehn Geschichten erzählt Klaus Kordon die Geschichte des 20. Jahrhunderts. So wird das Lebensgefühl dieser unterschiedlichen Zeiten anhand der Schicksale der in den Erzählungen vorkommenden Personen nachvollziehbar und nachfühlbar. Das Buch eignet sich auch um Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, die deutsche Geschichte nahezubringen. Ein wunderbares Buch!
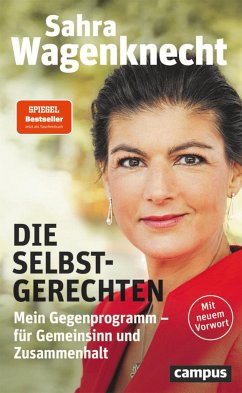 Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und Zusammenhalt
Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und ZusammenhaltDie Frau nervt. Natürlich hat sie Recht, wenn sie sagt, dass heutzutage eine Partei, wie die SPD nicht mehr wirklich die Interessen der Arbeiter und der einfachen Angestellten vertritt. Natürlich hat sie Recht, mit der Aussage, dass Outsourcing in der Regel bedeutet, dass die Angestellten dann weniger Geld für die gleiche Arbeit bekommen. Natürlich hat sie Recht, wenn sie beschreibt, dass es einen Schwund an Industriearbeitsplätzen in der Produktion gibt und dafür mehr so genannte „bullshit-jobs”, wodurch die Angst vor dem sozialen Abstieg zur prägenden Erfahrung für viele Menschen wurde.
Verdammt nochmal — ist das meine Schuld? Muss ich mich jetzt auch noch darum kümmern?
Und hilft das Gewese, welches sie gerade veranstaltet mit ihrer Parteigründung, aus dieser Situation raus? — Nö! Wie auch?
Wer jetzt sich immer noch aufregen möchte, muss das Buch lesen.
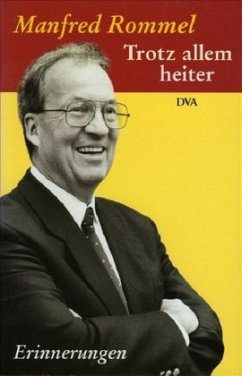 Manfred Rommel: Trotz allem heiter Erinnerungen
Manfred Rommel: Trotz allem heiter ErinnerungenManfred Rommel kam wenige Monate vor meinem Vater zur Welt. Zu Glück sind die Erinnerungen meines Vaters, der in etwa gleich alt ist, wie Manfred Rommel, weniger traumatisch als die von Manfred Rommel: Als Fünfzehnjähriger musste er miterleben, wie sein Vater von Hitlers Todeskommando abgeholt und in den Selbstmord getrieben wurde.
In den Nachkriegsjahren war Manfred Rommel zunächst Finanzpolitiker in Baden-Württemberg und arbeitete zeitweise auch in Bonn. Später war er Stuttgarter Oberbürgermeister und als solcher im In- und Ausland hoch geschätzt.
In dem Buch werden viele Ereignisse berichtet, die ich als Kind am nur Rande mitbekam, wenn meine Eltern oder Großeltern über diese Ereignisse sprachen und diskutierten.
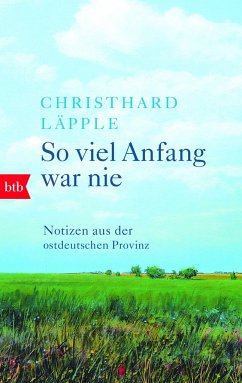 Christhard Läpple: So viel Anfang war nie Notizen aus der ostdeutschen Provinz
Christhard Läpple: So viel Anfang war nie Notizen aus der ostdeutschen ProvinzDen Autor kenne ich seit Kindertagen, da sein Vater ein Vetter meiner Mutter war. Was ich nicht wusste, dass er offenbar, so wie ich, später auch nach der Wende in den Osten Deutschlands gezogen war und dort Erfahrungen gemacht hat, die wohl in das Buch »So viel Anfang war nie« eingeflossen sind. jedenfalls handelt es sich hier um eine sehr plastische Wiedergabe dessen, was offenbar die Wende in den Menschen eines kleinen Dorfes ausgelöst hat.
In deutlich abgeschwächter Form ist es das, was auch viele mir heute so aus der Wendezeit berichtet haben. Insofern war das Buch für mich ein zusätzlicher Einblick in das Seelenleben der Ostdeutschen nach der Wende. Das hat zu meinem Verständnis für die Menschen beigetragen und ein wenig weitergeholfen.
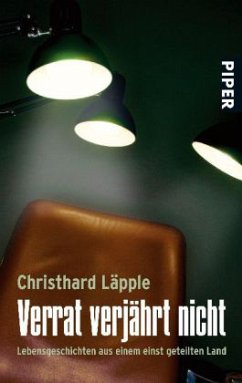 Christhard Läpple: Verrat verjährt nicht Lebensgeschichten aus einem einst geteilten Land
Christhard Läpple: Verrat verjährt nicht Lebensgeschichten aus einem einst geteilten LandDieses Buch, in dem es offenbar um die Stasi geht, ist 10 Jahre vor dem anderen erschienen und liegt noch zum Lesen in meinem Bücherregal.
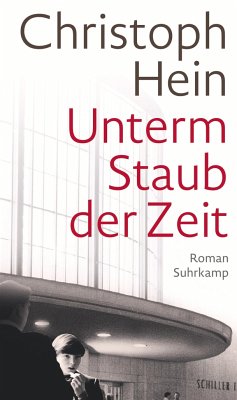 Christoph Hein: Unterm Staub der Zeit
Christoph Hein: Unterm Staub der ZeitWieder ein „Kalter Krieg-Bewältigungs-Titel” — Das ist nicht abschätzig gemeint. — Diesmal geht es um einen Pfarrerssohn, der in der DDR kein Abitur machen durfte. (Auf irgend eine Art und Weise taucht hier schon wieder Angela Merkel als Pfarrerstochter und Ausnahme auf: Sie durfte im Osten Abitur machen und studieren. War das die Frauenquote? Und was wäre passiert, wäre Angela ein Mann gewesen?)
Solange die Grenze noch offen war, konnten diese Kinder in den Westen, in ein Schülerheim ziehen, wo sie wohnten und von wo aus sie ins Gymnasium gingen. Typischerweise waren das kirchliche Einrichtungen für die Kinder der »armen Glaubensbrüder und -schwestern« im Osten.
Später konnten seine Eltern nach Ostberlin ziehen. Er wohnte ab da wieder bei ihnen und pendelte täglich in sein westberliner Gymnasium. — Bis quer durch Berlin eine Mauer gebaut wurde . . .
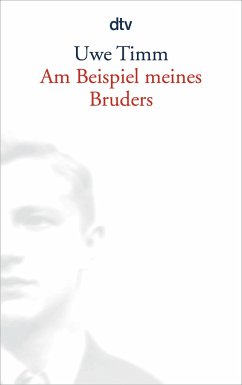
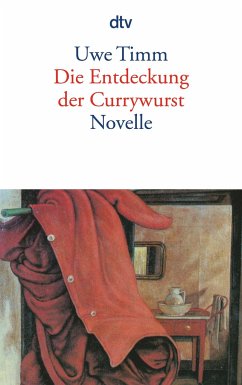 Uwe Timm: Am Beispiel meines Bruders
Uwe Timm: Am Beispiel meines BrudersUwe Timm: Die Entdeckung der Currywurst Novelle
Uwe Timm schreibt über seinen 1924 geborenen und 1943 in einem Lazarett in der Ukraine verstorbenen älteren Bruder. Er hatte sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Man könnte sagen — eine Geschichte, wie es sie in Deutschland häufig gab. Uwe Timm konnte die Geschichte erst nach dem Tod der Mutter und der älteren Schwester aufschreiben, als sie bei den Angehörigen nicht mehr neue Verletzungen, Wut oder Abwehr generieren konnte. Diese zeitliche Distanz kommt dem Buch zugute.
Das zweite Buch von Uwe Timm habe ich im Urlaub gelesen. Es geht im eine im Altersheim lebende über 80-jährige, die berichtet, wie sie kurz vor Kriegsende einen jungen desertierten Marinesoldaten in ihrer Hamburger Wohnung versteckt hat und ein Liebesverhältnis mit ihm angefangen hat. Um ihn nach Ende des Krieges nicht zu verlieren verschweigt sie ihm, dass die Wehrmacht in Hamburg längst kapituliert hat. Sie hält ihn in ihrer Wohnung fest, versorgt ihn mit Fake-News über die angeblich fortdauernden Kämpfe und mit Nahrung.
 Arye Sharuz Shalicar1 (hebräisch: אריה שרוז שליקר) wuchs als Sohn von aus dem Iran stammenden Eltern jüdischen Glaubens
im Berlin der 80er und 90er-Jahre auf. 2001 wanderte er nach Israel aus.
Arye Sharuz Shalicar1 (hebräisch: אריה שרוז שליקר) wuchs als Sohn von aus dem Iran stammenden Eltern jüdischen Glaubens
im Berlin der 80er und 90er-Jahre auf. 2001 wanderte er nach Israel aus.
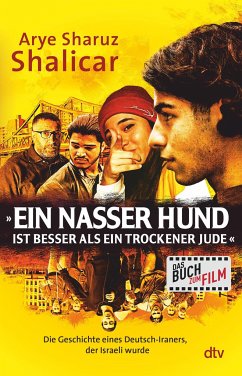 In seiner Autobiographie mit dem Titel Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde, berichtet er über
seine Erfahrungen, die er in seiner Jugend in Berlin machte.
Identifizierte man ihn als nicht 100%-Deutschstämmigen, erlebte er sich stets als nicht 100% dazugehörig, als fremd im eigenen Land.
Nur in seiner kriminellen Jugendgang im Wedding wurde er schließlich akzeptiert. Was dieses
Buch so besonders macht, ist das Verständnis des Autors sowohl für die Befindlichkeit der Muslime (egal ob sie aus dem arabischen Raum oder aus dem Iran
stammen), für die Befindlichkeit der Juden (in Deutschland und in Israel) und sein Wissen um die Denkweisen der Deutschen.
In seiner Autobiographie mit dem Titel Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde, berichtet er über
seine Erfahrungen, die er in seiner Jugend in Berlin machte.
Identifizierte man ihn als nicht 100%-Deutschstämmigen, erlebte er sich stets als nicht 100% dazugehörig, als fremd im eigenen Land.
Nur in seiner kriminellen Jugendgang im Wedding wurde er schließlich akzeptiert. Was dieses
Buch so besonders macht, ist das Verständnis des Autors sowohl für die Befindlichkeit der Muslime (egal ob sie aus dem arabischen Raum oder aus dem Iran
stammen), für die Befindlichkeit der Juden (in Deutschland und in Israel) und sein Wissen um die Denkweisen der Deutschen.Die Entscheidung darüber, was wir mit den aus dem Buch gewonnenen Erkenntnissen anfangen und ob wir zwischen den verschiedenen Gruppen im eigenen Land Brücken bauen wollen oder nicht, müssen wir, die Leser, aber selber treffen. Dass das nicht ohne Konflikte abgeht, haben wir ja in den vergangenen Tagen schon erlebt.
1 Von Oktober 2009 bis Anfang 2017 war Shalicar einer der vier offiziellen Sprecher der israelischen Armee. Seit 2017 arbeitet er in der israelischen Regierung. Er ist dort Abteilungsleiter des Bereichs internationale Beziehungen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, 2023, wurde er wieder als Sprecher der israelischen Streitkräfte reaktiviert.
2021 war dieser Roman verfilmt worden.
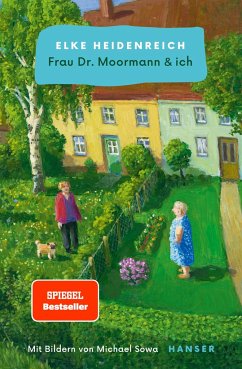 Elke Heidenreich: Frau Dr. Moormann & ich
Elke Heidenreich: Frau Dr. Moormann & ichIn der Buchbesprechung auf buecher.de steht »Eine nachbarschaftliche Hassliebe voller Leidenschaft. Elke Heidenreich brilliert mit sprühendem Witz und klugen Beobachtungen.« — dem ist nichts hinzuzufügen.
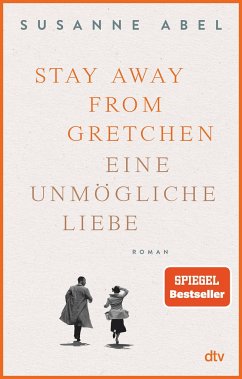 Susanne Abel: Stay away from Gretchen Eine unmögliche Liebe
Susanne Abel: Stay away from Gretchen Eine unmögliche LiebeAls Denis Scheck das Buch in der ARD vorstellte, sagte er: »Dieser gut konstruierte Roman (...) erinnert daran, wie lang der Weg aus einem von Rassismus und Bigotterie geprägten Nachkriegsdeutschland war und welche Wegstrecke zu einer gerechteren Gesellschaft noch vor uns liegt.«. Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich hier wiederhole. Es ist ein Segen, dass jetzt in der Literatur immer wieder die Nachkriegszeit in den Blick kommt und aufgearbeitet wird. Vieles von dem, was in dem Buch beschrieben wird, habe ich auch noch in den 60ern des vergangenen Jahrhunderts mitbekommen, aber eben erst später verstanden.
Kurz zum Inhalt: Ein schwarzer GI verliebt sich in Heidelberg in ein deutsches Mädchen. Es kommt ein Kind zur Welt und die Beiden wollen heiraten, was von den Eltern des Mädchens verhindert wird. Das deutsche Jugendamt entzieht der Mutter das Kind und das Kind kommt in diverse Heime. Die Mutter sucht das Kind, findet es aber nicht mehr, denn es wurde mittlerweile, mit der Begründung, da gehe es dem Kind besser, zur Adoption in die USA verbracht.
Obwohl das ein 544-Seiten-Buch ist, wird es zu keinem Zeitpunkt langweilig.
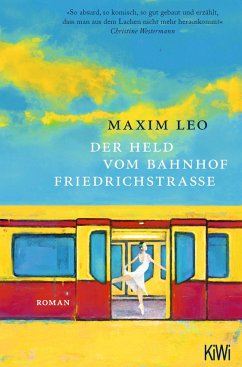 Maxim Leo: Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße
Maxim Leo: Der Held vom Bahnhof FriedrichstraßeDas Buch reflektiert indirekt das Verhältnis von Ost- und West-sozialisierten Menschen, wie sie auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, über 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik unterschiedlich ticken.
Michael Hartung, der früher als Stellwerksmeister bei der Ostberliner S-Bahn gearbeitet hatte, soll eine Massenflucht von 127 Menschen vom Bahnhof Friedrichsstraße aus in den Westen ermöglicht haben. So steht es in seinen Stasi-Akten und er bekommt jetzt Besuch von einem Journalisten, der Genaueres wissen will. Es dauert nicht lange, da wird Hartung als Held vom Bahnhof Friedrichstraße gefeiert und er ist beliebter, gern gesehener und gefeierter Gast in allen möglichen Fernsehsendungen.
Dass Michael Hartung eine solche Flucht niemals geplant hatte und dass er zufällig, aufgrund eines Missverständnisses, die Weiche so gestellt hatte, das hat plötzlich keinen Platz mehr in der medialen Wirklichkeit. Hartung ist am Ende ein Held wider Willen.
Ich habe mich während des Lesens mehrmals gefragt, wie kann der Autor eine so fulminant erzählte Geschichte vernünftig zu Ende bringen? Er tut es auf die meines Erachtens einzig mögliche Weise. Mehr sei nicht verraten. Brilliant!
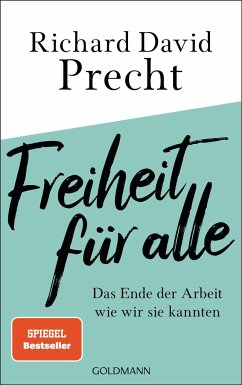 Richard David Precht: Freiheit für alle Das Ende der Arbeit wie wir sie kannten
Richard David Precht: Freiheit für alle Das Ende der Arbeit wie wir sie kanntenUnser Klassenlehrer der 4.Klasse hat uns prophezeit, dass wir es gut hätten, denn ab dem Jahr 2000 müssten wir nicht mehr arbeiten, denn dann würden die Waren von Robotern hergestelt und wir müssten dann nur noch die hergestellten Waren konsumieren.
Einerseits spotte ich immer, dass ich noch darauf warte, dass die Prophezeiung meines Klassenlehrers endlich in Erfüllung geht und dass er sich zeitlich doch sehr verschätzt hat. Dabei gerät aber leider aus dem Blick, dass mein Lehrer sich hinsichtlich der Roboter und der Computer nicht so sehr geirrt hat, die jetzt die Arbeitswelt prägen und er sehr wohl damit Recht hatte, dass es bei der Arbeit heutzutage immer weniger darum geht unsere Existenz zu sichern. Wir arbeiten um zur Erwerbsarbeitsgesellschaft dazuzugehören. Es kommt immer mehr auf die Qualität und die genauen Umstände des Arbeitens an und inwiefern die Arbeit der »Selbstverwirklichung« dient.
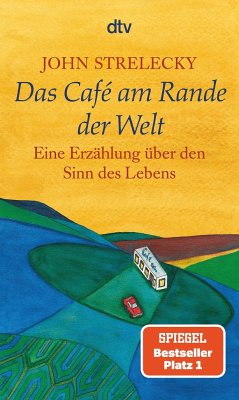 John Strelecky: Das Cafe am Rande der Welt Eine Erzählung über den Sinn des Lebens
John Strelecky: Das Cafe am Rande der Welt Eine Erzählung über den Sinn des LebensEin viel beschäftigter Werbemanager macht in einem Café halt. Auf der Speisekarte stehen neben dem Menü des Tages drei Fragen: »Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben?« Der Manager wird neugierig. Anstatt weiterzufahren bleibt er und beginnt mit Hilfe der Anwesenden über diese Fragen nachzudenken. Er schaut mit einem Mal ganz anders auf die Welt auf seine Beziehungen und auf seine Mitmenschen.
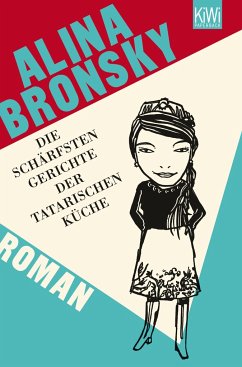 Alina Bronsky: Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche
Alina Bronsky: Die schärfsten Gerichte der tatarischen KücheIch habe das Buch vor Jahren gelesen und jetzt wiederentdeckt.
"Als meine Tochter Sulfia mir sagte, sie sei schwanger, wisse aber nicht, von wem", mit dem Satz beginnt der Roman. Die Tatarin Rosalinda ist die Ich-Erzählerin. Es fehlt Rosalia nicht an Selbstbewusstsein. Sie ist die Matriarchin, die versucht alles zu kontrollieren. Obwohl sie eine anstrengende, sehr herrische, ich-bezogene Person ist, hat ein Herz für ihre Enkelin und auch für ihre Tochter, auch wenn sie dies nicht direkt zeigen kann. Ganz nebenbei erfährt man viel über die russische Gesellschaft, gerade auch dadurch, dass dargestellt wird, was mit der Familie passiert, als sie in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ins Exil nach Deutschland zieht.
 Mark Aldanow: Der Anfang vom Ende
Mark Aldanow: Der Anfang vom Ende1919 floh der damals 33-jährige Autor, wie so viele seiner Landsleute, aus Kiew vor den Bolschewiken ins Exil nach Paris. Mark Aldanow ist ein Synonym für Mordechai-Markus Israeliwitsch Landau. Er war Nachkomme einer österreich-jüdischen Industriellenfamilie, hatte angeblich Jura und Naturwissenschaften studiert und arbeitete als Chemiker. Vor seinem 30 Geburtstag hatte er neben seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch „nebenbei” noch literaturhistorische Aufsätze und Bücher verfasst. Sein Roman »Der Anfang vom Ende« erschien 1943 in englischer Übersetzung. Vor seinem Tod 1957 äußerte Aldanow die Befürchtung, dass dieses Buch niemals in der Originalsprache auf Russisch erscheinen werde. Beinahe hätte er Recht gehabt. Es dauerte bis in die 1990er-Jahre, bis während dem Zerfall der Sowjet-Union das Buch auch auf Russisch erscheinen konnte.
Die meines Erachtens beste Zusammenfassung des Inhalts lieferte der 1981 geborene russische Journalist Sergei Lebedew: „Was Aldanows Buch heute so aktuell macht, ist dieses Gefühl der absoluten moralischen Katastrophe, die über Russland hereingebrochen ist, das Gefühl des 'Anfangs vom Ende'.”
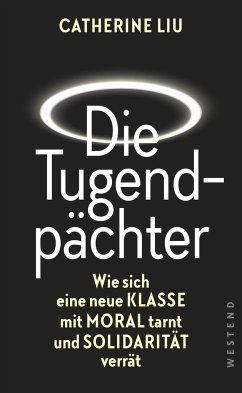 Catherine Liu: Die Tugendpächter
Wie sich eine neue Klasse mit Moral tarnt und Solidarität verrät
Catherine Liu: Die Tugendpächter
Wie sich eine neue Klasse mit Moral tarnt und Solidarität verrätTugendpächter, das sind wir. Wir haben die Tugend gepachtet.
Auch wenn das Buch ursprüngich die Entwicklung der gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Klassen und Rassen in den USA beschreibt — Es gibt es doch hinsichtlich des in dem Buch beschriebenen Pänomens, einer Professional Managerial Class (PMC), mehr Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und den USA, als ich auf den ersten Blick erwartet habe.
Wir, die wir Akademiker in gut bezahlter Stellung sind, dort Verantwortung tragen und uns engagieren. Wir wollen und können uns in unserer Position für moralisch möglichst adäquates, menschliches Vorgehen einsetzen. Und oft gelingt uns das auch. Wir äußern uns auch den Anderen gegenüber entsprechend.
Aber wir sind nicht konsequent. Ein Beispiel: Wir Ärzte sind der Meinung, dass die in der Pflege Arbeitenden viel besser bezahlt werden müssten. Man fragt sich nur — Was tun wir dafür? Letztlich tragen wir mit unserer Haltung weit mehr zu der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich bei, als wir das wahrhaben wollen.
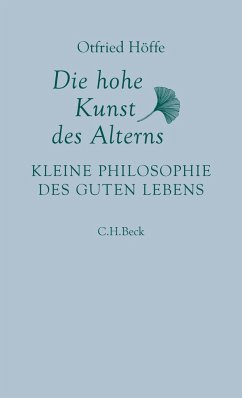
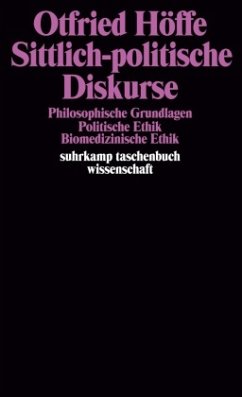 Otfried Höffe: Die hohe Kunst des Alterns
Kleine Philosophie des guten Lebens
Otfried Höffe: Die hohe Kunst des Alterns
Kleine Philosophie des guten LebensOtfried Höffe: Sittlich-politische Diskurse Philosophische Grundlagen, politische Ethik, biomedizinische Ethik
Ich weiß nicht mehr, wo ich auf Otfried Höffe gestoßen bin. Er wurde Professor in Tübingen, zwei Jahre nachdem ich von dort weg bin. Ich weiß nur, dass ich früh in meinem Medizinstudium die 1981 erschienenen »Sittlich-politischen Diskurse« in die Hände bekam. Ich war fasziniert von ihm, weil er zu der Zeit als wir im Medizinstudium zum Beispiel uns damit beschäftigt haben, welche neuen Möglichkeiten die Genetik bot. Als einer der Ersten hat er die daraus resultierenden ethischen Dimensionen diskutiert: Welche Eingriffe ins menschliche Genom sind erlaubt? Welche sind wann, unter welchen Umständen, sittlich geboten? Welche Eingriffe sind unethisch? Haben genetisch geschädigte Kinder ein Klagerecht gegenüber den Eltern oder dem behandelnden Arzt?
Jetzt im näherrückenden Alt-Sein konnte ich sein Buch über's Altern nicht links liegen lassen. Sobald ich's fertiggelesen habe, geht's hier im Text weiter...
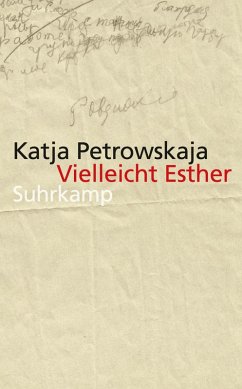 Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther
Katja Petrowskaja: Vielleicht EstherDas Buch ist mir beim Ausräumen unserer Wohnung in die Hände gefallen. Ich muss es vor 6-7 Jahren gelesen haben. Die Autorin erhielt für dieses Buch 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Jetzt ist es leider nur noch antiquarisch oder als ebook erhältlich.
Seit 1999 lebt die 1970 in Kiew geborene Autorin in Berlin. In dem Buch beschreibt sie eine Reise zurück in den Osten um Spuren ihrer jüdischen Großmutter zu finden. — In Kiew, Mauthausen, Warschau und Wien kann die Autorin jeweils Fragmente ihrer Familiengeschichte dem Vergessen entreisen.
Eine Schwierigkeit habe ich mit dem Buch: Das ist der inhalts-assoziative Stil. Je nach Thema
springt die Autorin durch die Jahrzehnte und von Generation zu Generation. Ich muss mir dann immer wieder die
generationellen Zusammenhänge klarmachen, die die Autorin natürlich viel klarer vor Augen
hat. Da bin ich froh, wenn ich in meiner eigenen Familie den Überblick behalte. Das ist aber eine der Macken meines
Gehirns. Das spricht in keiner Weise gegen das Buch.
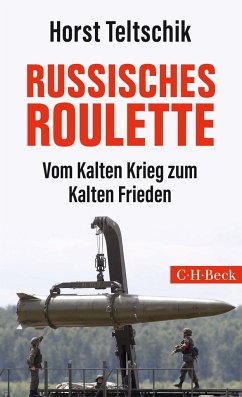 Horst Teltschik: Russisches Roulette
Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden
Horst Teltschik: Russisches Roulette
Vom Kalten Krieg zum Kalten FriedenHorst Teltschik, der ehemalige außenpolitische Berater Helmut Kohls und langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz hat dieses Buch im Jahre 2019 herausgebracht. In aus heutiger Sicht geradezu hellseherischer Art und Weise zeigt er in dem Buch die seiner Meinung nach von der NATO und deren Staaten im Umgang mit Russland gemachten Fehler auf:
Er moniert, dass im Jahre 2000 Putins Russland noch als befreundetes Land gelten konnte, trotz der bereits 1999 erfolgten Aufnahme von Polen, Tschechien und Ungarn in die NATO. Als 2004 neben der Slowakei und Slowenien auch Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland und Litauen der NATO beitraten, war das russische (Rest-)Einflussgebiet, bestehend aus Weißrussland und der Ukraine fast vollständig von NATO-Staaten eingekreist. Was das in Russland auslösen könnte, wurde im Westen nur am Rande wahrgenommen und bedacht. Immerhin hatte die deutsche Regierung 2008 einen NATO-Beitritt der Ukraine noch aktiv verhindert.
Wenn man bedenkt, dass im Jahre 1991 noch ein NATO-Beitritt Russlands erwogen worden war und dass Russland bis 1997 einen Sitz im NATO-Rat innehatte, dann wird deutlich, wie wenig in der Folge auf die Befürchtungen Russlands geachtet wurde und wie wenig Wert auf eine vertrauensbildende Politik gegenüber Russland Wert gelegt wurde.
Am Anfang der russischen Klage über die NATO steht immer noch James Bakers berühmte Formulierung „Not one inch eastward“, die am 9. Februar 1990 in einem Treffen mit Gorbatschow fiel. Damals verzichtete Gorbatschow allerdings auf eine schriftliche Fixierung dieser Aussage, die von amerikanischer Seite als Verhandlungsposition und von russischer Seite als Zusicherung aufgefasst wurde.
All das rechtfertigt natürlich nicht den Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine, aber es lohnt sich, das Buch zu lesen und zu überlegen, was wir in Zukunft besser machen können.
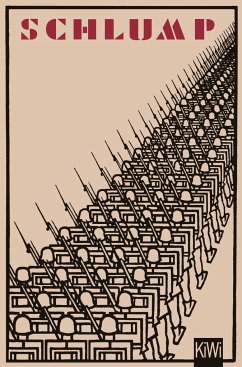 Hans Herbert Grimm: Schlump
Hans Herbert Grimm: SchlumpDieses Buch fiel mir kürzlich beim Räumen in die Hände. Meine Tochter hatte dieses Buch gelesen. Es ist gewissermaßen die unbekanntere Variante zu Erich Maria Remarques Antikriegsbuch »Im Westen nichts Neues«. Der Autor hat an beiden Weltkriegen als Soldat teilgenommen. Während des zweiten Weltkriegs hatte er das Buch angeblich vorsichtshalber in der Wand eingemauert, weil er Razzien der Nazis befürchtete. Schließlich gehört dieses Buch auch zu den Büchern, die die Nazis verbrannt haben.
Das Buch war initial unter einem Pseudonym erschienen. Erst nach dem zweiten Weltkrieg im Rahmen des Gedenkens an die Autorinnen und Autoren der in der Nazizeit verbrannten Bücher lüftete die Schwiegertochter des Autors das Geheimnis der Autorenschaft und stellte klar: Hans Herbert Grimm, ihr Schwiegervater, hatte diesen Roman über den 1. Weltkrieg geschrieben.
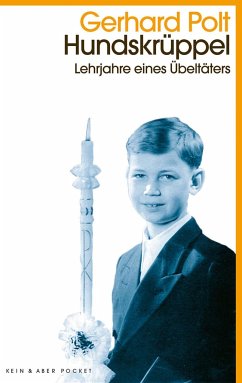 Gerhard Polt: Hundskrüppel Lehrjahre eines Übeltäters
Gerhard Polt: Hundskrüppel Lehrjahre eines ÜbeltätersSelten habe ich beim Lesen eines Büchleins so oft gelacht, wie bei diesen Kindheitserinnerungen von Gerhard Polt. Ein Beispiel:
»In einer Metzgerei aufzuwachsen ist ein Privileg, welches von anderen Kindkollegen nicht genug beneidet werden kann. Wenn man im Besitz von echten Kuhaugen, Schweinsbladern, Ochsenfieseln oder gar Stierhörndln ist, dann hat es der liebe Gott besonders gut mit einem gemeint. Im Gegensatz zu Brutstätten trostloser Fadheit, wie Kindergärten etwa, ist eine Metzgerei ein Event-Paradies, und selbst die Horrorfilme für die Kleinsten sind eine matte Sache verglichen mit einer Hinrichtung – der Enthauptung eines Gockels zum Beispiel –, wo man in der ersten Reihe sitzt, wo das echte Blut spritzt und man mit ansehen darf, wie der Kopf abfällt, während der Rest des Gockels noch über den Schuppen fliegt. ... «
Ausgesprochen langweilig war es in Gerhard Polts Kindheit anscheinend nicht. In dem Stile geht es weiter ... und wenn Vieles bei ihm ganz anders war als in meiner Kindheit, er ist ja auch 20 Jahre älter als ich, so erkannte ich doch manches von dem wieder, was da in seiner Zeit los war.
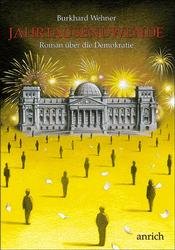 Burkhard Wehner: Jahrtausendwende
Roman über die Demokratie
Burkhard Wehner: Jahrtausendwende
Roman über die DemokratieDieses Buch ist mir beim Räumen in unserer Wohnung in die Hände gefallen. Wie bei so manchen Schätzen dort, kann ich mich gar nicht mehr erinnern wann und unter welchen Umständen ich zu diesem Buch gekommen bin. Es ist aktuell auch nur noch antiquarisch erhältlich
Der Roman wirkt im Jahre 2023 ziemlich aus der Zeit gefallen: Er spielt in der schon-PC- aber noch nicht Handy-Zeit. Die Protagonistinnen des Romans schreiben ihre Gedanken selbst auf und benutzen dafür Stift und Papier. Diese beschriebenen oder bedruckten Papiere schicken sie dann, mit Hilfe einer heute kaum mehr bekannten Institution, der »Deutschen Post« (schon seit 1995 nicht mehr »Bundespost« !), den Anderen zu. Diese Leute wissen also noch, was »ein Briefkasten« ist und wo sich ein solcher befindet. Dank dieser Beförderungsart sind diese Papiere auch nicht sofort bei der Adressatin, dem Adressaten verfügbar.
Aber nun zum Eigentlichen: Für mich liegt die Stärke des Buchs nicht in der Handlung. Einzig die darin enthaltenen und diskutierten Ideen über die Demokratie sind interessant. Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sehe ich gerade hier im Osten bei vielen hier lebenden Mitmenschen immer noch massive Mängel im Demokratieverständnis. Der Staat, das sind in der Regel immer noch »die da oben«, die machen was sie wollen, wo wir keinen Einfluss haben. Allerdings gebe ich mich keinen Illusionen hin: Auch im Westen Deutschlands ist es leider nur eine kleine Minderheit, die sich politisch engagiert.
Nochmal: Der Wert des Buches liegt nicht in seinem Unterhaltungswert, sondern darin, dass es anregt sich über unser demokratisches Gemeinwesen wieder Gedanken zu machen.
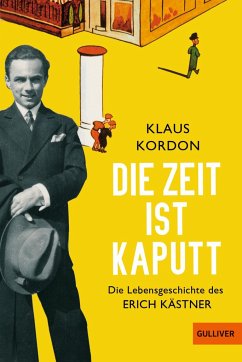 Klaus Kordon: Die Zeit ist kaputt Die Lebensgeschichte des Erich Kästner
Klaus Kordon: Die Zeit ist kaputt Die Lebensgeschichte des Erich KästnerNeben vielen historischen Büchern hat Klaus Kordon auch eine Art Biographie über Erich Kästner geschrieben. Während andere Werke eher Kästner als Kinderbuchautor würdigen, zeigt Klaus Kordon auch die anderen Seiten Erich Kästners: Er war ja auch „Satiriker, Journalist, Lyriker und Moralist - ein hellwacher Beobachter seiner Zeit” steht korrekterweise in der Besprechung zum Buch auf buecher.de.
Erich Kästner war sogar dabei als die SA-Leute seine Bücher ins Feuer warfen. Zum Glück wurde er von denen damals nicht erkannt. Obwohl er ein klarer Gegner der Nazis war, ist er nicht emigriert. Er hätte mehrmals Gelegenheit dazu gehabt. Dass er nicht emigrierte, wurde ihm nach dem Krieg auch zum Vorwurf gemacht. Seine Kinderbücher waren in der deutschen Bevölkerung sehr beliebt und waren Bestseller. Das mag einer der Gründe gewesen sein, warum die Nazis ihn nicht einfach einsperrten und umbrachten. Gerettet hat ihn ferner, dass er seit dem 1. Weltkrieg ein Herzleiden hatte und damit für den Dienst als Soldat untauglich war. Er war außerdem ein gefragter Drehbuchautor und Filme wurden noch bis zum Ende des Krieges gedreht. Der Bevölkerung sollte damit suggeriert werden: Trotz des Krieges läuft in Deutschland alles nach Plan und wir können so weitermachen bis zum Endsieg.
Das Kriegsende erlebte Kästner in Österreich als Mitglied eines Teams, welches den Dreh eines Durchhalteparolenfilms simulierte. Damit wurde effektiv verhindert, dass die Crew-Mitglieder zur Wehrmacht eingezogen wurden. Wenn das aufgedeckt worden wäre, wären sicher alle hingerichtet worden.
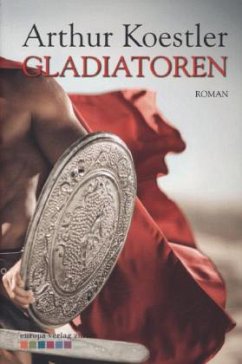 Arthur Koestler: Gladiatoren Leider gibt's das Buch aktuell nur antiquarisch.
Arthur Koestler: Gladiatoren Leider gibt's das Buch aktuell nur antiquarisch.1939 erschien Arthur Koestlers Debüt-Roman „Gladiatoren”, in dem er die Geschichte vom Aufstand des Sklaven Spartakus gegen die römische Sklaverei beschreibt. Koestler erzählt die Geschichte als eine aus Gewalt geborene Rebellion. Es ist die Abrechnung mit gewalttätigen Regimen, wie dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus.
Was viele nicht wissen: Bei der heute vorliegenden Ausgabe handelt es sich um eine Rückübersetzung aus dem Englischen. Die deutschen Originalmanuskripte sind Arthur Koestler auf der Flucht vor den Nazis nach England verloren gegangen. Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, was diese Leute durchmachen mussten!
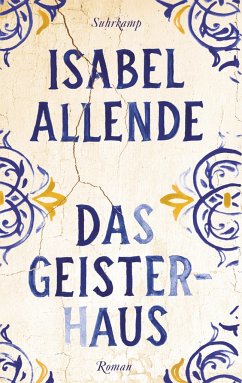 Isabel Allende: Das Geisterhaus
Isabel Allende: Das GeisterhausIsabell Allendes Großonkel, Salvador Allende, war von 1970 is 1973 Präsident von Chile. Er wollte eine demokratisches an sozialistischen Idealen orientiertes Staatswesen errichten. 1973 putschten die Militärs um Augusto Pinochet und errichteten eine lange Jahre andauernde Militärdiktatur.
Isabel Allendes Erstlingswerk (bei Suhrkamp 1984 erstmals auf deutsch erschienen) wurde gleich ein Bestseller. Das Buch erzählt die Geschichte einer großbürgerlichen Familie in Chile. Esteban Trueba der Familienvater ist ein gewalttätiger Patriarch. Seine ganze Umgebung hat unter ihm zu leiden: Seine Bauern behandelt er wie Leibeigene. Er unterdrückt auch seine eigene Familie. Es kommt zum Putsch gegen den sozialistischen Staatspräsidenten, Isabells Großonkel. Unter der nachfolgenden Militärdiktatur herrschen Terror und Verfolgung. Auch die Familie Trueba ist betroffen. Isabel Allende beschreibt das alles. Die Autorin stellt aber der grausamen Wirklichkeit eine magisch anmutende Fantasiewelt gegenüber, die die Düsternis immer wieder mit Hoffnungsschimmern aufhellt. Das macht die Lektüre all dieser Gräuel erträglich, ja sogar schön.
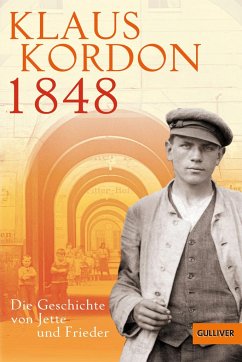
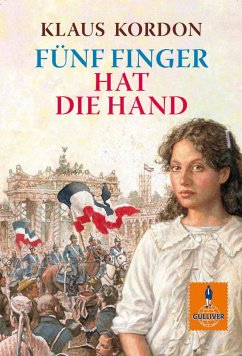
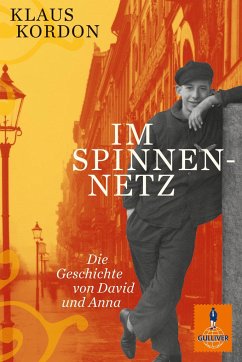 Klaus Kordon: 1848 Die Geschichte von Jette und Frieder
Klaus Kordon: 1848 Die Geschichte von Jette und Frieder1848 ist der erste Teil einer Trilogie von Klaus Kordon über die Welt des 19.Jahrhunderts in Deutschland. Die anderen beiden Bände Fünf Finger hat die Hand und Im Spinnennetz sind Teil 2 und 3 der Trilogie.
Anhand der Liebesgeschichte zwischen dem 15-jährigen Waisenmädchen Jette und dem 17-jährigen Zimmermann Frieder gelingt es Klaus Kordon aufzuzeigen, unter welchen Verhältnissen die Menschen im vorrevolutionärem Berlin damals ihr Leben fristen mussten. Möglicherweise hätte es eines solchen Buches bedurft, dass ich mich damals im Gymnasium mehr für das Fach Geschichte interessiert hätte. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen pflegen die Ansicht, dass „die da oben” sowieso machen, was sie wollen und dass das aktuelle politische System doch „völlig korrupt” sei. Sie sollten dieses Buch lesen, um zu begreifen, was es wirklich bedeutet in einer Gesellschaft ohne Freiheit der Presse, ohne unabhängige Berichterstattung, ohne unabhängige Richter, ohne am Gesetz orientierter Rechtssprechung und ohne gleiches Recht für Alle zu leben.
Dabei bin ich weit davon entfernt zu behaupten, bei uns wäre alles in Ordnung, der Ausgleich zwischen Oben und Unten, zwischen Arm und Reich, zwischen Alt und Jung wäre schon gelungen. Es gibt noch viel zu tun .... Aber es ist wichtig, dass wir auch dankbar sehen, wie gut es uns doch im Vergleich zu den Menschen in Deutschland im Jahr 1848 geht und was für eine Wert es ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo man sich für seine Meinung engagieren kann, darf und soll und wo man sich gegen Ungerechtigkeiten häufig mit Erfolg zur Wehr setzen kann. → Pflichtlektüre!
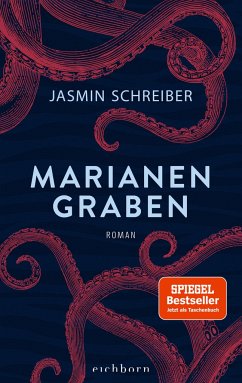 Jasmin Schreiber: Marianengraben
Jasmin Schreiber: MarianengrabenAuf dem Friedhof treffen sich zufällig nachts die junge Paula, deren geliebter jüngerer Bruder im Alter von 10 Jahren verstorben ist, und der alte Mann, Helmut, dessen Ex-Ehefrau dort ebenfalls beigesetzt ist. Die Notwendigkeit einen Weg zu finden mit der Trauer adäquat umzugehen um weiterleben zu können, schweißt die beiden ungleichen Protagonisten auf ihrer Reise durch fast ganz Deutschland zusammen.
Die Rückseite des Buches ziert ein Satz von Sascha Lobo: »Eigentlich kann man gar kein Buch schreiben, das vom Sterben handelt, gleichzeitig sehr lustig und tieftraurig ist, sich aber anfühlt wie ein Roadmovie.«
Das trifft die Sache genau. Man muss oft lachen, aber es ist kein albernes Gewitzel. Ein Meisterstück!
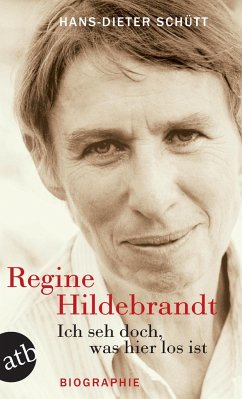 Hans-Dieter Schütt: Regine Hildebrandt Ich seh doch, was hier los ist
Hans-Dieter Schütt: Regine Hildebrandt Ich seh doch, was hier los istEs gibt in dem Buch eine Passage, in der aus einer Rede von Günter Grass zitiert wird, die er 1992 in den Münchner Kammerspielen gehalten hat. Er beschreibt darin eine »verhärtete Fremdheit« zwischen Ost- und Westdeutschen. Östlich der Elbe, sagte er, »liegt das Kind im Brunnen und schreit. Selber reingefallen und schreit. Was soll dieses Plärren? Da hört man schon nicht mehr hin! — Einzig die brandenburgische Sozialministerin Regine Hildebrandt hat Stimme genug, dem schreienden Kind zumindest zeitweilig Gehör zu verschaffen. Sie nennt das anhaltende Unrecht beim Namen. Diese Frau sprengt, sobald sie auftritt, die Mattscheibe. Sie straft die landesübliche Ausgewogenheit Lügen. Ihre Penetranz ist erfrischend, ihre Rede leidet nicht unter Glätte.«
Das mit dem »schreienden Kind«, trifft unser Verständnis der damaligen Situation, das wir im Westen hatten: Die Ossis sind bereitwilligst der Lüge Helmut Kohls von den „blühenden Landschaften” gefolgt. Das haben sie jetzt davon! Was soll das Herumgeheule, die haben es sich so ausgesucht — auch wenn sie letztlich nicht alle verstanden hatten, wofür sie sich da entschieden hatten! Unkenntnis schützt in einer Demokratie nicht vor der Verantwortung für eigene (Fehl-)Entscheidungen!
Ich habe das Buch vor Allem deshalb gerne gelesen, weil es mir noch einmal aus der Perspektive einer Frau aus dem Osten, die dem Regime kritisch gegenüber stand, die Ereignisse der Wendezeit vor Augen geführt hat, von denen wir viele schon wieder vergessen haben oder einige gar nicht mitbekommen haben.
Es sei mir erlaubt, noch zwei Sätze aus dem Buch zu zitieren: »Ich will dafür sorgen, daß uns morgen in Brandenburg nicht nur Golfbälle um die Ohren fliegen.« – »Ich will mich nicht an eine Realität gewöhnen, bei der Menschen in Pappkartons auf der Straße liegen.« ← Sätze, die sich im heutigen Politikbetrieb niemand mehr zu sagen traut, obwohl sie heute nicht viel weniger Aktualität haben als damals.
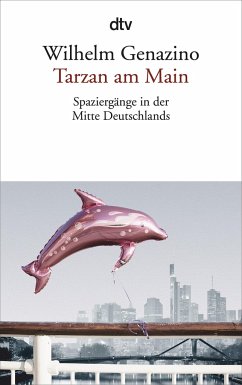 Wilhelm Genazino: Tarzan am Main Spaziergänge in der Mitte Deutschlands
Wilhelm Genazino: Tarzan am Main Spaziergänge in der Mitte DeutschlandsBerufliche „Zufälle” ... und plötzlich hatte ich Ende des Jahrtausends eine Stelle als IT-Controller in Frankfurt am Main. Das hieß arbeiten in der Metropole und wohnen im Frankfurter Umland, in der Provinz.
Das Büchlein habe ich nach Jahren jetzt über Weihnachten wieder einmal aus dem Bücherschrank gezogen. Es ist eine literarische Betrachtung der Spannung zwischen Provinz und Metropole, zwischen vertrauter Umgebung und Weltoffenheit. Frankfurt steht für mich für Beides und schöner als in diesem Büchlein fand ich's nirgends beschrieben.
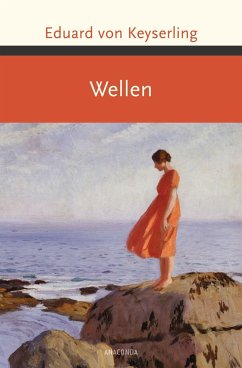
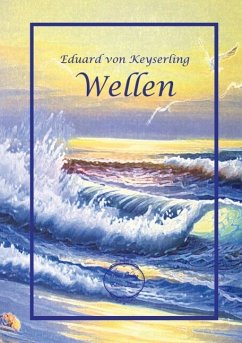
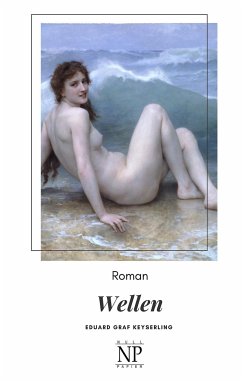
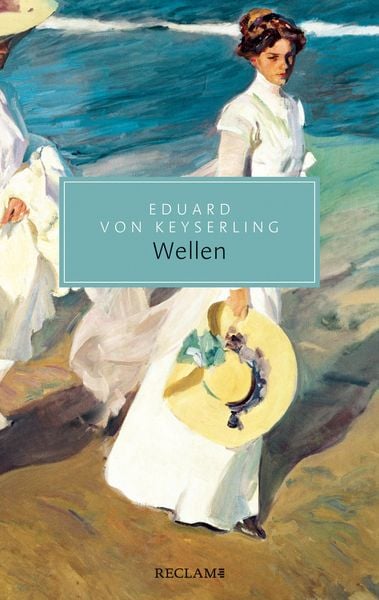 Eduard von Keyserling: Wellen
Eduard von Keyserling: WellenAuf dem Exemplar, welches ich von der Stadtbücherei ausgeliehen habe, steht hinten ein Zitat von Jens Malte Fischer „Keyserling ist der wahrscheinlich unbekannteste große deutsche Erzähler des Jahrhunderts.” (← gemeint ist da das 20. Jahrhundert). In Anbetracht dessen, dass sein Autor kaum bekannt ist, scheint es auch das Romanwerk mit den unterschiedlichsten und verschiedenartigsten Ausgaben zu sein.
Wenn man sich in den 1911 erstmals erschienenen Roman vertieft, denkt man zuerst, „Was für ein oberflächliches adlig-bürgerliches Gequatsche!”. Liest man weiter, dann wird einerseits das ganze Elend einer Gesellschaft offenbar, in der die Heldin Doralice, aufgrund ihrer Trennung von ihrem Ehemann eigentlich als nicht mehr gesellschaftsfähig gilt. Andererseits gelingt es von Keyserling meisterhaft ganz unlangweilig, das resultierende Beziehungsgeflecht aufzuzeigen. Am Schluss fragt man sich sogar, ob die Personen des Romans trotz ihres "eingemauert Seins" in gesellschaftlichen Konventionen nicht doch freier sind, als wir, da für uns doch scheinbar keine gesellschaftlichen einengenden Konventionen unseren Alltag regeln ... . Dass diese Zweifel aufkommen, mag aufzeigen, wie meisterlich der Autor diese uns fremde Gesellschaft schildert. Ich zähle das Buch jedenfalls ab sofort zu den großen Werken, die man gelesen haben muss.
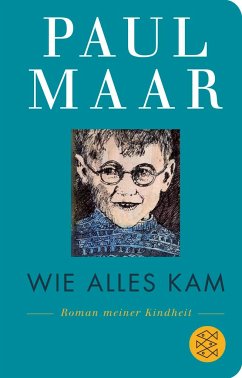 Paul Maar: Wie alles kam Roman meiner Kindheit
Paul Maar: Wie alles kam Roman meiner KindheitPaul Maar, der Sams-Erfinder, schildert in dem Buch seine Kindheit in einem Ort bei Schweinfurt. Es geht darum, wie er seine Mutter verlor, den aus dem Krieg heimkehrenden Vater nicht erkannt hat, was offenbar zu einer fortdauernd schwierigen Vater-Sohn-Beziehung beigetragen hat. Das Buch fasziniert wegen des geschilderten Muts und der Energie, mit der er dem Leben trotz widriger Umstände das Beste abgetrotzt hat.
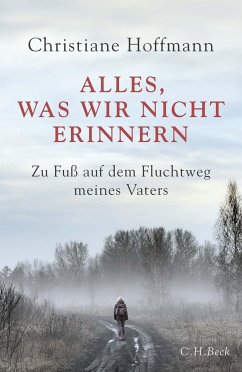 Christiane Hoffmann: Alles, was wir nicht erinnern Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters
Christiane Hoffmann: Alles, was wir nicht erinnern Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines VatersChristiane Hoffmann schildert zu Beginn des Buches, wie in ihrer Kindheit die Erwachsenen über die verlorene Heimat, Rosenthal in Schlesien, geredet haben. Das erinnert mich an die Erzählungen meines Onkels Alfred, der aus Königsberg stammte. Zeit seines Lebens gab es praktisch keine Begegnung mit ihm, während der nicht der Verlust seiner Heimat zur Sprache kam und was „der Russe” alles verbrochen hatte.
Paradoxerweise helfen mir diese Kindheitserinnerungen im Umgang mit meinen Patienten, die in ihrer Kindheit ein ähnliches Fluchtschicksal erleiden mussten.
Der eigentliche Wert des Buches liegt aber nicht nur darin, dass Christiane Hoffmann ihren Weg beschreibt. Noch interessanter sind die Begegnungen mit den Menschen, die heute dort vor Ort wohnen. Zu Beginn des Weges sind das Polen, deren Vorfahren ihrerseits aus Galizien, aus der heutigen Ukraine vertrieben wurden. Es wird nirgends die Schuld der Deutschen am zweiten Weltkrieg in irgendeiner Weise beschönigt, aber man bekommt durch das Buch doch ein sehr differenziertes Bild über die Befindlichkeiten der dortigen Bevölkerung. Man muss sich schon wundern ... . Während im Südwesten Deutschlands viele Französisch gelernt haben und sich heute auf Französisch gut verständigen können, ist dergleichen in den östlichen Gebieten Deutschlands gar nicht der Fall ... Niemand lernt Polnisch. ... Na ja, in Bayern lernt auch niemand Tschechisch, eher Latein....
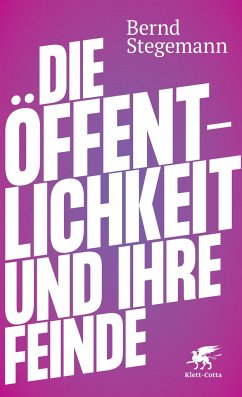 Bernd Stegemann: Die Öffentlichkeit und ihre Feinde
Bernd Stegemann: Die Öffentlichkeit und ihre FeindeDer politisch links stehende Bernd Stegemann hat einst Philosophie, Germanistik und Erziehungswissenschaften an der FU Berlin und an der Universität Hamburg studiert. Er ist heute tätig als Dramaturg und ist auch Professor an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Er ist für dieses Buch von allen Seiten massiv angegriffen worden. Von den Linken, weil er deren Diskursverhalten kritisiert hat, ... von den wirtschaftsfreundlichen Kreisen, weil er die These vertritt (die ich übrigens nicht teile), dass die aktuelle Diskurssituation eine mit Absicht herbeigeführte oder begünstigte Folge unseres neoliberalen Wirtschaftens sei, ... von den Konservativen und zugleich von den Sozialwissenschaftlern, weil er sich gewissermaßen als „Fachfremder” anmaßt eine soziologische Analyse unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation zu veröffentlichen.
Um diesen Shit-Storm beneide ich ihn nicht, aber ...
So richtig konnte ich bisher nicht verorten, woran es liegt, dass ich unsere bundesrepublikanische Gesellschaft immer debattierunfähiger erlebe. Da hat mir dieses Buch die Augen geöffnet. Selbst auf die Gefahr hin, dass das die Sache jetzt sehr verkürzt erscheinen lässt, möchte ich aus dem Buch zitieren:
»Grenzenlosigkeit, Diversität und Globalisierung werden nicht mehr als konkrete Machtverhältnisse beschrieben, sondern als allgemeine Werte für gut erklärt. So ist jede Kritik daran unmöglich, da der Kritisierende sich auf die moralisch böse Seite stellt. Und schließlich führt der neoliberale Umbau dazu, dass in der Öffentlichkeit nicht mehr Widersprüche, die alle betreffen ausgetragen werden, sondern jeder als privates Individuum dort auftritt. ... Gereiztheit und Gekränktheit sind die beiden Grundemotionen spätmoderner Öffentlichkeit.«
Im Prinzip behauptet er (so wie im obigen Zitat zum Neoliberalismus aufgezeigt), dass kritische Stimmen, Meinungen und Handlungen in unserer aktuellen Diskurssituation eher erst einmal diffamiert und moralisch niedergemacht statt gehört und wahrgenommen werden.
Schönstes aktuelles Beispiel ist für mich der Versuch die Straßenkleber der Last-Generation mit den Terroristen der RAF moralisch und rechtlich auf eine Stufe zu setzen. . „Was ist da gerechtfertigt?” „Wenn die Schweinebauern die Straße blockieren, dann gibt es Politiker, die da noch hinfahren und ihre Solidarität mit den Schweinebauern bekunden!” „Nötigung bleibt Nötigung!” „Die Wochenzeitung die Zeit hat extra einen ganzen Abschnitt mit der Diskussion gefüllt, inwiefern blockierte Autofahrer berechtigt sind die Blockierer von der Straße zu entfernen!” Was war gerade das Thema? Straßenblockade, RAF, Notwehr, Klima, Krise. Wer jetzt noch nicht die Schnaue voll hat von der „Diskussions . . . ” .
Diese Mechanismen beschreibt Bernd Stegemann als öffentlichkeitsfeindlich und er macht sich die Mühe, auch Diejenigen zu benennen, die jeweils ihren Beitrag dazu leisten, dass das so bleibt. Nicht ganz einfach zu lesen, aber aufschlussreich und wert zu diskutieren!
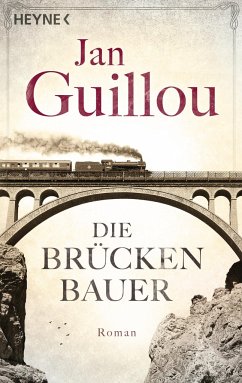 Jan Guillou: Die Brückenbauer / Brückenbauer Bd.1
Jan Guillou: Die Brückenbauer / Brückenbauer Bd.1Ein faszinierendes Buch über drei Fischerjungen aus Norwegen, die zu Halbwaisen werden. Dank eines Stipendiums können sie studieren und werden die besten Brückenbauer des Landes.
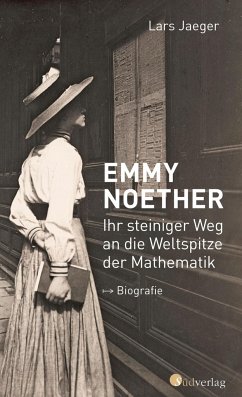 Lars Jaeger: Emmy Noether Ihr steiniger Weg an die Weltspitze der Mathematik
Lars Jaeger: Emmy Noether Ihr steiniger Weg an die Weltspitze der MathematikBiographien lese ich eigentlich kaum, das ist nicht so mein Ding. Diese Biographie über Emmy Noether habe ich aber fast in einem Rutsch durchgelesen. Es war nicht der unglaubliche Männerdünkel oder der konsequent diskriminierende Umgang, dem Emmy Noether zeitlebens ausgesetzt war, die mich faszinierten, nein. — Emmy Noether hat die abstraktesten, am wenigsten anschaulichen Themen der Mathematik bahnbrechend weiterentwickelt. So verhalf sie beispielsweise Albert Einstein dazu, das mathematische Grundgerüst zu seiner allgemeinen Relativitätstheorie widerspruchsfrei zu formulieren. Sie war in regem Austausch mit den führenden Mathematikern und Physikern ihrer Zeit und die schätzten ihre Arbeit.
Lars Jaeger ist es gelungen, diese Themen auch für Leute mit mathematischer Halbbildung, wie mich,
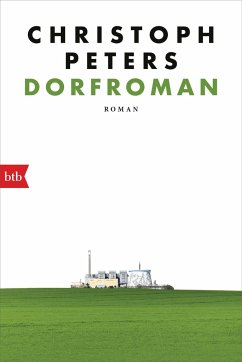 Christoph Peters: Dorfroman
Christoph Peters: DorfromanWir befinden uns in den 70er-Jahren in Hülkendonck, einem kleinen Dorf am Niederrhein, nahe Kalkar, wo der schnelle Brüter gebaut werden soll, wo für die katholisch geprägte Bevölkerung der sonntägliche Kirchgang Pflicht ist und wo nur der (Farb-)Fernseher die weite Welt ins Haus bringt. Das und, wie das Projekt „Schneller Brüter” die Gesellschaft spaltet, schildert der Dorfroman.
Wenn mich ich heute aufrege und es beängstigend finde, wie Zukunftsfragen zu Verwerfungen in unserer Gesellschaft führen, so führt mir dieses Buch vor Augen, dass es solche Verwerfungen schon früher gab. Offenbar habe ich sie damals nicht als so bedrohlich wahrgenommen.
Obwohl ich niemals ein 100-prozentiger Atomkraftgegner war, bin ich heute froh, dass wir in Deutschland den Ausstieg aus der Energieerzeugung mittels Atomkraft fast geschafft haben.
Tatsächlich macht mir das Buch indirekt, ohne dass das Absicht des Autors ist, Mut, dass wir es heute auch wieder schaffen uns den Zukunftsfragen, wie
- Klimawandel oder
- Verringern Spaltung zwischen Arm und Reich oder
- Pflege im Alter zu stellen
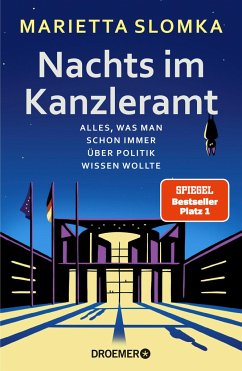 Marietta Slomka: Nachts im Kanzleramt Alles, was man schon immer über Politik wissen wollte
Marietta Slomka: Nachts im Kanzleramt Alles, was man schon immer über Politik wissen wollteIch bin erstaunt und neugierig wo sich Marietta Slomka nachts so rumtreibt . . .
Wo – erfahren Sie, wenn ich das Buch gelesen habe — Na ja, 'mal sehen!
Nachdem ich es gelesen hatte, musste ich leider feststellen: Für mich ist das Buch ein totaler Fehlkauf – nicht deshalb, weil ich immer noch nicht weiß, was nachts im Kanzleramt passiert oder wo sich Marietta Slomka nachts so rumtreibt . . . Das Buch ist, abgesehen vom Titel, das beste Lehrbuch über Politik und Demokratie, welches ich je in den Händen gehalten habe. Für einen politisch Interessierten, wie mich, bringt es aber leider nichts Neues. Aber ich werde es meiner Tochter geben. Ich bin neugierig, was die dazu sagt.
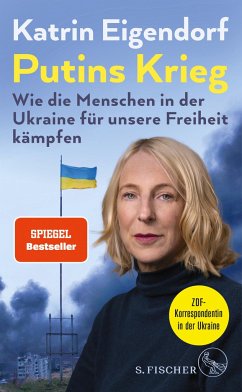 Katrin Eigendorf: Putins Krieg
Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen
Katrin Eigendorf: Putins Krieg
Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfenInitial fand ich den Untertitel nicht angebracht. Ich dachte, wie anmaßend das zu behaupten. Je länger man in dem Buch liest, desto klarer wird es...
... Wenn Putin gewinnen würde, wäre auch unsere Freiheit bedroht. Auch wenn darin furchtbare Sachen geschildert werden – Alle sollten's lesen.
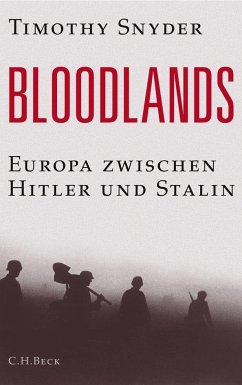 Timothy Snyder: Bloodlands
Europa zwischen Hitler und Stalin 1933-1945
Timothy Snyder: Bloodlands
Europa zwischen Hitler und Stalin 1933-1945Dieses Buch hat mir ein guter Freund im Urlaub zum Lesen gegeben. Ich hab's erst einmal beiseite gelegt. Aber wenn man die heutige Situation, gerade auch die in der Ukraine, besser verstehen will, muss man's lesen. Leider keine schöne Lektüre!
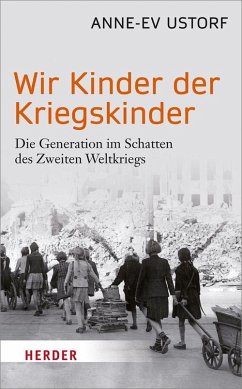 Anne-Ev Ustorf: Wir Kinder der Kriegskinder
Anne-Ev Ustorf: Wir Kinder der KriegskinderDas Buch zeigt auf, wie auch unsere Generation in ihren Haltungen und Gewohnheiten noch vom zweiten Weltkrieg geprägt ist — und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Alle Baby-Boomer sollten's lesen.
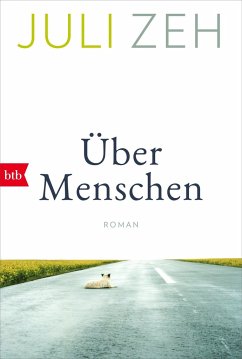
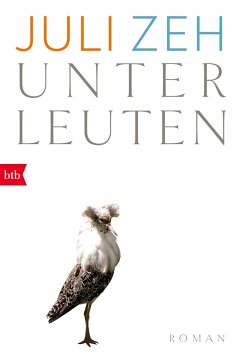 Juli Zeh: Über Menschen
Juli Zeh: Über MenschenJuli Zeh: Unterleuten
In gewisser Weise ist der Roman „Über Menschen” die Fortsetzung von „Unterleuten”. Das Buch Über Menschen beschreibt, was passiert, als eine Berliner Großstädterin in Corona-Zeiten vor ihrem in Klimafragen sich immer ideologischer gebärdenden Partner in die Brandenburgische Provinz flieht. Da holen sie Fragen ein wie: Welche Leute sind für mich wichtig für den alltäglichen Umgang? Wie mit dem Nachbarn umgehen, der von sich selbst sagt, er sei der Dorf-Nazi?
Denis Scheck sagte dazu: »Ein Buch, das einem die Augen öffnet für unsere bundesrepublikanische Wirklichkeit.« Die eigentliche Frage ist aber, welche „Wirk”–lichkeit wir zulassen wollen bzw. zulassen können.
Zum Roman Unterleuten ist auf buecher.de zu lesen:
» Unterleuten ist ein Ort im Bundesland Brandenburg, an dem Juli Zeh in ihrer Phantasie rund zehn Jahre verbracht hat. Sie kennt diesen Ort wie kaum ein anderer. Sie kennt alle Einwohner, jede Hausecke, jeden Stein.
Der Gesellschaftsroman Unterleuten stellt sich dem „Kampf der Kulturen“. Große kulturelle Unterschiede gibt es bekanntermaßen zwischen Ost und West, zwischen Morgenland und Abendland, zwischen Islam und Christentum. Doch Juli Zeh stellt in ihrem Buch fest, die Unterschiede auf der ganzen Welt bestehen vor allem zwischen Stadt und Land. So zeigt sie die Differenzen zwischen einem Berliner und einem Einwohner des kleinen Örtchens Unterleuten auf. «
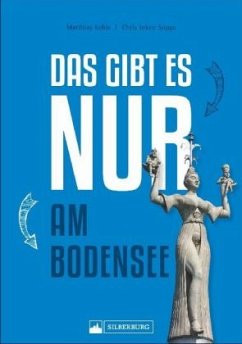 Matthias Kehle, Chris I. Soppa: Das gibt es nur am Bodensee
Matthias Kehle, Chris I. Soppa: Das gibt es nur am BodenseeDas Buch hatte ich meinem Vater geschenkt. Keine große Literatur, aber wenn man das Büchlein durch hat, dann weiß man über viele Schätze und Sehenswürdigkeiten am Bodensee Bescheid und hat zugleich noch etwas über die lokale Geschichte erfahren. Ich weiß nicht, warum das Buch gerade verramscht wird.
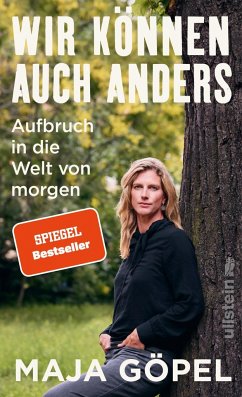 Maja Göpel: Wir können auch anders Aufbruch in die Welt von Morgen
Maja Göpel: Wir können auch anders Aufbruch in die Welt von MorgenInsgesamt 57 Cent Kosten erspare ich der Gesellschaft (nicht mir selbst) für jeden Kilometer, den ich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklege. So habe ich das noch nie gesehen.
In dem Buch geht es unter Anderem darum, dass wir bei den aktuellen Diskussionen nicht nur darauf achten dürfen, was uns das kostet, wenn wir „Das oder Das” verändern. Nur wenn wir auch darauf schauen, was es uns kostet, wenn wir „Das oder Das” nicht verändern, stimmt die Kalkulation.
Das Buch zeigt auf, wie uns das systemische Denken abgeht und wie uns das systemische Denken weiterbringen kann, wenn es um die aktuellen Bedrohungen, wie Erderwärmung oder soziale Ungerechtigkeit oder Wiedererkennen der (Selbst-)Wirksamkeit der gesellschaftlichen Gruppen geht.
Maja Göpel erklärt wunderbar, wie es passieren konnte, dass eine schwedische Schulschwänzerin die Ikone der neuen Klimabewegung wurde. Nach dem Lesen des Buches haben wir eigentlich keine Ausrede mehr und können nicht sagen, wir seien zu unbedeutend, zu unfähig oder zu unbekannt, um etwas verändern zu können. Das Buch raubt mir die Rechtfertigung, mich mit den Worten „das wird ja eh nicht klappen” zurücklehnen zu können, um mich „Not-gedrungen” der selbstgerechten Untätigkeit hinzugeben. Besser nicht lesen!
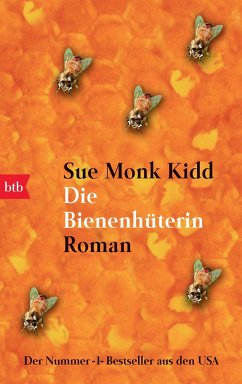 Sue Monk Kidd: Die Bienenhüterin
Sue Monk Kidd: Die BienenhüterinDieses Buch habe ich in der Ferienwohnung im Urlaub entdeckt. Ein sehr US-amerikanisches Buch. Es war in den USA über lange Zeit Nr 1.-Bestseller. Es geht um ein Schusswaffenunglück, um einen gewalttätigen Vater, um aus rassistischen Gründen misshandelnde Polizisten und um 3 schwarze Schwestern (Ohh Nein! Ich muss ja schreiben: „3 Schwestern, people of color”!), 3 Imkerinnen, welche dem Mädchen und seiner Freundin Liebe entgegenbringen und Geborgenheit verschaffen.
Es ist in zweiter Linie ein Roman über das Verhältnis von schwarzer und weißer Bevölkerung in den Südstaaten der USA und es sind hier die Schwarzen, die einem weißen pubertierenden Mädchen helfen erwachsen zu werden und ihre traumatische Familiengeschichte zu überwinden.
Sorry, wenn ich mich hier über Gender- und Minderheiten-gerechte Sprache
lustig zu machen scheine. Ich bin da etwas empfindlich, aus dem Wissen heraus,
dass die Verwendung „korrekter Sprache” noch lange
nicht bedeutet, dass die Autor(inn)en solcher Texte auch wirklich eine
adäquate innere Haltung haben. Besonders falsch finde ich,
wenn man alle Spuren einer aus heutiger Sicht „nicht korrekter
Sprache” zu tilgen versucht. Dadurch geht das Wissen verloren,
wie früher geredet wurde und der Fortschritt im Denken wird unsichtbarer.
Wenn also, wie ich im Urlaub in Konstanz
bemerkt habe, eine
Mohren-Apotheke nicht mehr Mohren-Apotheke heißen darf...
Für mich ist Mohr zunächst einmal eine historische Benennung
eines Menschen mit schwarzer Hautfarbe und keine Herabwürdigung.
Anders würde ich es sehen, wenn die Apotheke
„Neger-Apotheke” heißen würde.
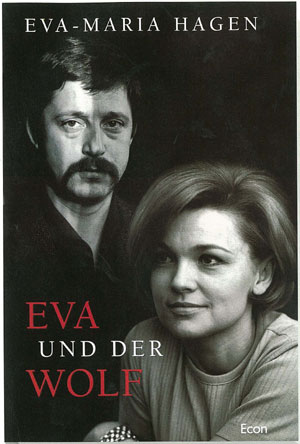 Eva-Maria Hagen: Eva und der Wolf
Buchtitelbild © www.eva-maria-hagen.de
Eva-Maria Hagen: Eva und der Wolf
Buchtitelbild © www.eva-maria-hagen.de
Aus Anlass des Todes von Eva-Maria Hagen habe ich mir dieses Buch aus der Stadtbücherei geholt, welches ich nur empfehlen kann. Wenn man etwas über Wolf Biermann erfahren will, dann dort. Leider gibt's das Buch nur antiquarisch. Aber vielleicht wird es ja jetzt nochmal neu aufgelegt.
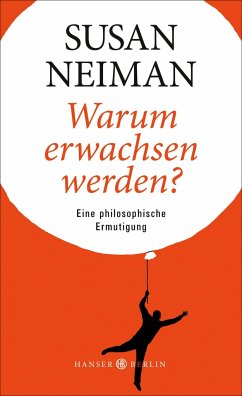 Susan Neiman: Warum erwachsen werden? Eine philosophische Ermutigung
Susan Neiman: Warum erwachsen werden? Eine philosophische ErmutigungIch erinnere mich noch, wie uns im Gymnasium die Philosophie Rousseaus „nahegebracht” wurde: Es wurde eher abfällig von der so genannten »Rousseau'schen Idylle« gesprochen und Rousseau unterstellt, er habe die Kinder ohne Erziehung und Kulturtechniken, »nur in der Natur« aufwachsen lassen wollen. Was dabei herauskomme, wurde uns vor Augen geführt, könne nur eine Kaspar Hauser-ähnliche Kreatur sein. Damit war für uns die Philosophie Rousseaus ein für alle Mal als »Quatsch« diskreditiert.
Erst beim Lesen dieses Buches von Susan Neimann habe ich verstanden, was für ein Unsinn uns da erzählt wurde: In seinem Roman Emile schildert Rousseau Methoden um Kinder an das Leben heranzuführen, die heute als modern gelten: Interesse wecken, erlebnisorientierte Pädagogik (Sternbeobachtung im Wald, Orientierung anhand der Sterne um den Nach-Hause-Weg zu finden).
Letztlich beschreibt Susan Neimann Erwachsen-Werden als Weg aus der Unmündigkeit - ganz im Kant'schen Sinne. — Macht Spaß zu lesen!
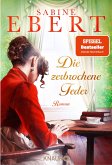 Sabine Ebert: Die zerbrochene Feder
Sabine Ebert: Die zerbrochene FederSabine Ebert hat einen guten Ruf als Autorin gut recherchierter historischer Romane. Es geht um die Zeit ab Ende 1815: Napoleon ist besiegt und es ist die Zeit der Restauration. Nicht nur die alten Herrscher erhalten ihre Macht zurück, nein auch Bürgerrechte und gesellschaftliche Fortschritte, die die Herrschaft Napoleons eben auch mit sich gebracht haben, werden wieder rückgängig gemacht. Es geht um das Schicksal einer jungen Witwe, deren Schilderungen des Kriegsleids nicht nur bei den wieder eingesetzten Zensoren sondern auch an höchster Stelle missfällt, weshalb sie kurzerhand aus Preussen verbannt wird. Dabei hat sie noch das Glück bei ihrem Onkel im sächsischen Freiberg aufgenommen zu werden. Aber gerade auch in Sachsen wurde das Rad zurückgedreht: Auch hier gibt es verschärfte Zensur. Kein Gedanke an Pressefreiheit. Es kommt sogar zu Bücherverbrennungen. Attentate werden als Heldentaten gefeiert.
Wie immer in Sabine Eberts Büchern wird einem die historische Situation plastisch vor Augen geführt und man kann sich vorstellen, wie sich die Menschen damals gefühlt haben mussten. Am Ende schaffen es die Held(inn)en der Bücher Sabine Eberts aber aus ihrem Leben etwas zu machen. - Tolles Buch!
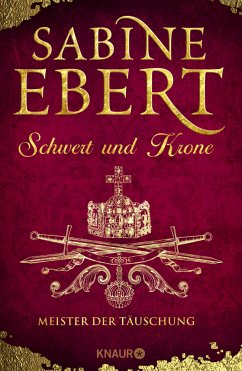
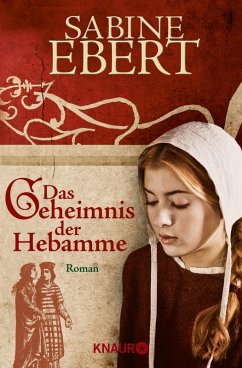 Sabine Eberts 5-bändige Buchreihe über die Barbarossa-Ära und
Sabine Eberts 5-bändige Hebammen-Buchreihe habe ich vor Jahren jeweils komplett gelesen. Es lohnt sich!
Sabine Eberts 5-bändige Buchreihe über die Barbarossa-Ära und
Sabine Eberts 5-bändige Hebammen-Buchreihe habe ich vor Jahren jeweils komplett gelesen. Es lohnt sich!
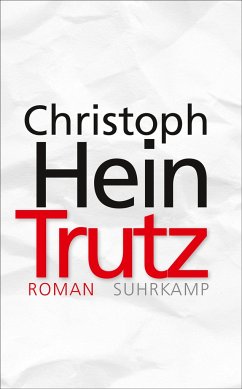 Christoph Hein: Trutz
Christoph Hein: TrutzDas Buch erzählt die Geschichte zweier Familien über 2 Generationen. Eine davon ist die Familie „Trutz”. Vater Trutz ist Buchautor und Journalist. Als religiöser Sozialist traf er sich in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts jede Woche mit Gesinnungsgenoss(inn)en in einem Gesprächskreis, der von der Theologie des in Frankfurt lebenden und lehrenden Paul Tillich ein deutscher und später US-amerikanischer protestantischer Theologe inspiriert war. In dem Kreis lernte er auch seine Lebensgefährtin und spätere Ehefrau kennen.
Nach der Machtergreifung Hitlers verlor er seine Stelle bei der Zeitung und bekam auch als freier Journalist keine Aufträge mehr. Schlimmer noch: Der Inhaber des Verlags, der seine Bücher herausgegeben hatte, machte ihn für den Image-Schaden verantwortlich, der dem Verlag daraus entstanden sei, als die Nationalsozialisten Trutz' Bücher auf die schwarze Liste gesetzt hatten. Dadurch wurden die Bücher unverkäuflich.
Aus dem Kreis der religiösen Sozialisten erhielt nur der spiritus rector Paul Tillich selbst das erhoffte Visum für eine Ausreise in die USA. In letzter Sekunde gelang es Trutz und seiner Lebensgefährtin, dank der Hilfe einer in der sowjetischen Botschaft tätigen Freundin, ein Visum für die Sowjetunion zu bekommen und nach Moskau zu fliehen.
In Moskau hatte er keine Chance in seinem alten Beruf zu arbeiten. Er musste froh sein, eine Stelle als Bauarbeiter in der internationalen Brigade „Karl Marx” zu bekommen. Intern wurde so ein Mitglied der Brigade als дермовщик bezeichnet, was sich, wenn man höflich ist, mit „Kloputzer” übersetzen lässt. Da ging es seiner Ehefrau in ihrer Stelle in der Schokoladenfabrik schon besser. Das Paar pflegte Freundschaft mit der Familie eines Professors, der mit seinem Sohn und dem Sohn der Familie Trutz Gedächtnisübungen machte.
Nach einigen glücklichen Jahren trifft die beiden Familien das ganze Ausmaß der Repression, welches in der damaligen Sowjetunion herrschte. Es kommt zur Verbannung nach Sibirien. Erst Jahrzehnte später treffen sich die Söhne beider Familien in Deutschland wieder.
Wer bis dahin noch nicht abgeschreckt ist, dem empfehle ich dieses Buch. Die (Nicht-)Reaktionen der russischen Zivilgesellschaft auf die aktuellen Ereignisse versteht man besser, wenn man sich mit Hilfe dieses Buches klar macht, dass es in den vergangenen 100 Jahren nur eine kurze Phase der gab, in der in Russland freie Meinungsäußerung ohne negative Konsequenzen möglich war.
 Steffen Kopetzky: Monschau
Steffen Kopetzky: MonschauWestdeutschland, die Eiffel zu Beginn der 60er-Jahre. In dem Ort Monschau brechen die Pocken aus. Keine Pandemie, aber doch eine Epidemie mit allen bekannten Schikanen: Quarantäne für ganze Familien, Überforderung der lokalen Medizininfrastruktur (Ein Krankenhaus muss gesperrt werden und kann keine Kranken mehr aufnehmen). Es gibt dennoch den teils hilflosen Versuch das „normale Leben” weitgehend, wie bisher, aufrecht zu erhalten. Aus Düsseldorf kommt ein Professor samt Assistent, der den Krisenstab leitet.
Tatsächlich beruht das Buch auf einem realen Ereignis, einer Pocken-Epidemie Anfang der 60er-Jahre in der Eiffel. Überraschend aktuell ... und doch wieder nicht, denn die gesellschaftlichen Regeln haben sich seit den 60er-Jahren doch verändert...
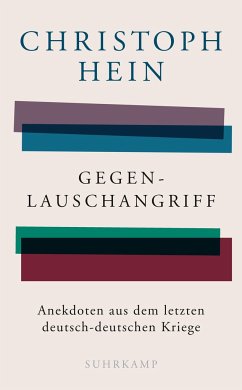
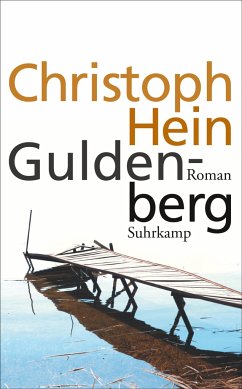
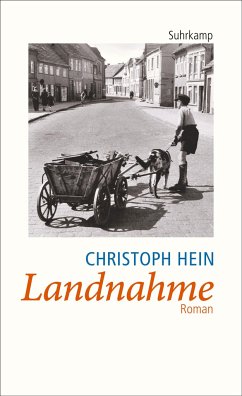 Christoph Hein: Gegenlauschangriff
Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege
Christoph Hein: Gegenlauschangriff
Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen KriegeChristoph Hein: Guldenberg
Christoph Hein: Landnahme
„Gegenlauschangriff” bietet einen tiefen Einblick in das Leben eines Literaten in den letzten 20 Jahren der DDR und den ersten Jahren des wiedervereinigten Deutschland. Die Aussage des Klappentexts, dass dies Christoph Heins persönlichstes Buch sei, kann ich nur bestätigen.
Dass die „Wiedervereinigung” der beiden deutschen Staaten, in vielerlei Hinsicht letztlich ein Anschluss der ehemaligen DDR an die Bundesrepublik war, das ist inzwischen hinlänglich bekannt. Aber neu waren für mich die Details, die Christoph Hein schildert. Für viele Kulturschaffende brachte das Ende der DDR eben nicht die erhoffte neue Freiheit und die erhofften neuen Möglichkeiten. Im Gegenteil: Sie sahen sich plötzlich einem Konkurrenzkampf ausgesetzt, in dem sie, die Neuen, die Nicht-Etablierten waren und deshalb wieder einmal diejenigen, die zurückstecken mussten und es schwer hatten.
Mit „Guldenberg” ist der Autor ganz in unserer Gegenwart angekommen. Wie schon im „Gegenlauschangriff” stehen sich zwei Kulturen gegenüber: Auf der einen Seite die Etablierten, die schon mit dem System vertrauten und auf der anderen Seite, diejenigen, die aus ihrer alten Heimat fliehen mussten, in dem Fall junge Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien. Es gelingt Christoph Hein hier sehr gut aufzuzeigen, wie Ängste, Ignoranz und der Rassismus das Zusammenleben behindern und bestimmen.
Das dritte Buch im Bunde, „Landnahme” beschreibt das Leben eines aus den „ehemaligen Ostgebieten Deutschlands” Vertriebenen, der nach Guldenburg (ja auch hier „Guldenburg”!) kam, als Landnahme. Was wir in unserer Generation gar nicht so mitbekommen haben: Die Vorurteile, mit denen damals die Vertriebenen bedacht wurden, und die Vorurteile gegenüber den Flüchtlingen heute, bewegen sich auf demselben erschreckenden Niveau. Auch die Ignoranz gegenüber dem Schicksal der jeweils Anderen, schenkt sich nichts. Auch wenn einen das sehr betroffen macht: Sehr lesenswert.
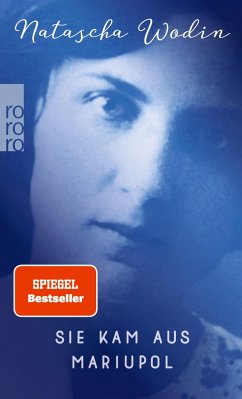 Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol
Natascha Wodin: Sie kam aus MariupolNatascha Wodin war 10 Jahre alt, als ihre Mutter 1956 wortlos die Wohnung verließ und nicht wiederkam.
Ihre Mutter stammte aus der Ukraine, aus Mariupol. Von dort war sie 1944 von den Deutschen (ich schreibe bewusst nicht: „von den Nazis”) als „Fremdarbeiterin” ins Deutsche Reich, nach Leipzig, verschleppt worden, wo sie in einer Rüstungsfabrik Zwangsarbeit leisten musste. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann, den Vater der Autorin kennen. Die Familie blieb nach dem Ende des Krieges in Deutschland, denn wären sie in die Ukraine zurückgekehrt, hätte man sie dort eventuell als Kollaborateure mit den Nazis hingerichtet. Also lebten sie nach dem Krieg in einer Siedlung für so genannte „heimatlose Ausländer”.
50 Jahre später hatte die Autorin den Namen ihrer Mutter ‚einfach so’ in eine Internet-Suchmaschine eingegeben und wurde fündig. Das Buch ist das Resultat einer sich daran anschließenden atemberaubend geschildertem Recherche, bei der Natascha Wodin nach und nach Zeitzeugen und Dokumente zutage förderte, die die Lebensgeschichte der Mutter bezeugen konnten. Die Mutter hatte sowohl russische Adlige als Vorfahren als auch italienische Einwanderer, die vor der Revolution reiche Unternehmer waren und nach der Revolution Alles verloren.
Das Buch hat gar nichts mit dem aktuellen Ukraine-Krieg zu tun. Das ist völlig egal, es ist einfach so spannend.
Letztlich stellt sich hier ↑ die Frage nach der deutschen Schuld an den durch den zweiten Weltkrieg
verursachten Leiden nochmals völlig neu: Wir fühl(t)en uns den Russen
gegenüber schuldig. Dabei hatte die Bevölkerung der Ukraine
genauso zu leiden. Das ist eine im deutschen Bewusstsein weitgehend
verdrängte Geschichte, was einen Teil der ‚Holperigkeiten’ der
deutsch-ukrainischen Beziehungen erklärt!
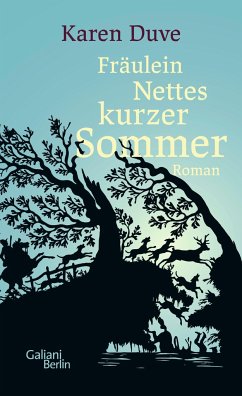 Karen Duve: Fräulein Nettes kurzer Sommer
Karen Duve: Fräulein Nettes kurzer SommerWahrscheinlich ein Frauenbuch ?!? Dieses Buch habe ich wieder im Bücherschrank entdeckt: Für jemanden, der wie ich am Bodensee aufgewachsen ist und einmal das Meersburger Schloss besichtigt hat, ist Annette von Droste-Hülshoff ein Begriff. Dennoch wusste ich, bevor ich dieses Buch gelesen hatte, nicht wirklich etwas Substanzielles über sie. Diese Biographie erzählt von der Lebenskatastrophe von Annette von Droste-Hülshoff: Für eine Frau, die sich nicht einfach anpassen will, sich nicht einfach einen Mann zuordnen lassen will, die ihren eigenen Kopf hat: Für die war's noch Jahrzehnte zu früh. Die Leute um sie herum waren noch dem Feudalismus verhaftet. Dafür war's aber zu spät, denn die französische Revolution hatte bereits stattgefunden und die Welt war im Umbruch.
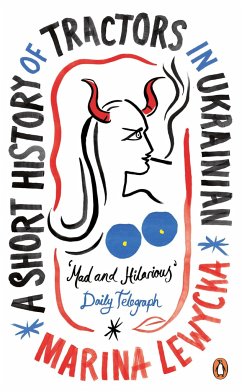
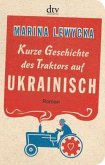 Marina Lewycka: A Short History of Tractors in Ukrainian
Marina Lewycka: A Short History of Tractors in UkrainianMarina Lewycka: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch
Nur wegen des Wortes Ukrainisch habe ich dieses Buch nochmal in die Hand genommen. Mit der aktuellen Situation in der Ukraine hat es aber nichts (wirklich: gar nichts!) zu tun.
Ein 84-Jähriger verliebt (?!?) sich zwei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau in eine 36-jährige Ukrainerin, die so alle Vorurteile bestätigt, die man haben kann:
- Blond,
- in erster Linie Oberweite D,
- nicht sehr gebildet,
- hat es wohl auf das Vermögen des 84-Jährigen abgesehen,
- usw.,
- usw..
Das Beste hätte ich beinahe vergessen: Man erfährt wirklich etwas über die Geschichte des Traktors!
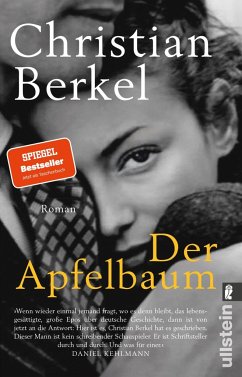 Christian Berkel: Der Apfelbaum
Christian Berkel: Der ApfelbaumDer Schauspieler Christian Berkel erzählt die Geschichte seiner Eltern: Die Mutter stammt aus einer intellektuellen jüdischen Familie, der Vater ist ein Sproß der Arbeiterklasse. Im zweiten Weltkrieg wird die Mutter in einem KZ in den Pyrenäen interniert, während der Vater als Sanitätsarzt an der Ostfront dient. Zehn Jahre lang haben die beiden sich nicht gesehen, trotzdem finden sie sich wieder. Christian Berkel erzählt die Geschichte über 3 Generationen. Die Stationen der Geschichte sind: Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau, zuletzt noch Buenos Aires. Während des Lesens steht einem der Mund offen und man denkt, „Das gibt's doch gar nicht!” — Brilliant erzählt!
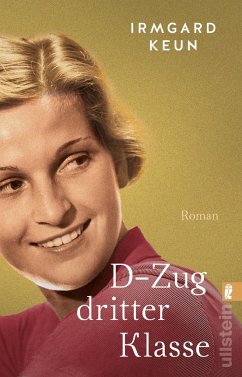 Irmgard Keun: D-Zug dritter Klasse
Irmgard Keun: D-Zug dritter KlasseDiese Autorin ist eine Wiederentdeckung: Irmgard Keun wurde 1905 in Berlin geboren. In der Zeit vor dem 2. Weltkrieg war sie eine bekannte und erfolgreiche Schriftstellerin. 1936 ging sie ins Exil. Vier Jahre später kehrte sie mit falschen Papieren nach Deutschland zurück, wo sie unerkannt lebte. Ihre nach dem Krieg erschienenen Bücher hatten nicht den Erfolg, wie ihre Vorkriegswerke. Erst in den Siebzigerjahren wurde sie von einem breiten Publikum wiederentdeckt.
Den Roman schrieb die Autorin im Exil: Im Abteil im Zug nach Paris sitzen 6 Menschen. Jede(r) von ihnen hat ein Geheimnis .... und nicht jede(r) kommt da an, wo sie oder er hin will....
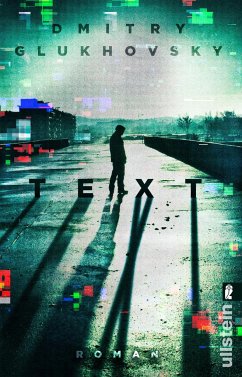
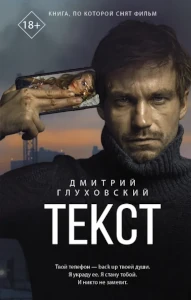
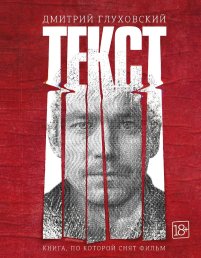 Dmitry
Glukhovsky: Text
Dmitry
Glukhovsky: TextДмитрий Алексеевич Глуховский: Текст
Ein weiterer Grund Amazon zu boykottieren ist die Tatsache, dass Amazon auf seiner Website keine russisch-sprachigen Bücher mehr verkauft. Man kann ja darüber streiten, ob man Autoren, die den Angriffskrieg Putins unterstützen, protegieren muss. Die pauschale Verbannung aller russisch-sprachigen Bücher aus dem Handel trifft mit Sicherheit auch die Falschen. Der Autor dieses Buches gehört wohl auch dazu, denn er ist bestimmt kein Freund Putins.
In dem Buch „Text” geht es um einen Mann namens Ilja, der nach sieben Jahren Straflager endlich nach Hause kommt. Er sucht jenen Fahnder auf, der ihn sieben Jahre zuvor zu Unrecht hinter Gitter gebracht hatte, tötet ihn und nimmt dessen Identität an. Das Buch zeigt Abgründe einer Gesellschaft auf, in der der Einzelne nicht auf sein Recht pochen kann, sondern der Willkür ausgesetzt ist.
Glukhovsky zeichnet in dem Roman, der eigentlich ein Krimi ist, ein düsteres Bild der russischen Gesellschaft. Die implizite These lautet hier: Die Zugehörigkeit zu familiären Netzwerken oder (kriminellen) Clanstrukturen ist weit wichtiger für den persönlichen/beruflichen Erfolg eines Jeden als Leistung oder Orientierung an ethischen Prinzipien.
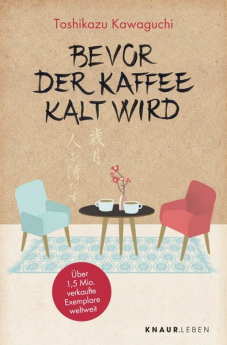 Toshikazu Kawaguchi: Bevor der Kaffee kalt wird
Toshikazu Kawaguchi: Bevor der Kaffee kalt wirdEine skurrile Geschichte, ... eigentlich vier skurrile Geschichten. In einem Cafe in Japan kann man unter bestimmten Umständen in die Vergangenheit reisen, ... jedenfalls so lange der Kaffee nicht kalt wird.
Von vier dieser Vergangenheitsreisen berichtet das Buch. Man beginnt unwillkürlich zu reflektieren, zu welchen Stellen des eigenen Lebens man sich so eine Rückreise wünschen würde. Zum Glück ist mir da nichts Wesentliches eingefallen. Dennoch fand ich das Buch nicht nur in dieser Hinsicht anregend.
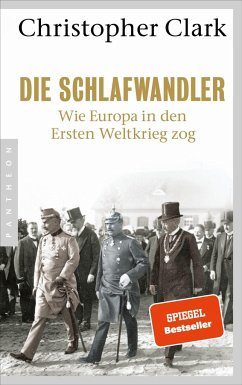
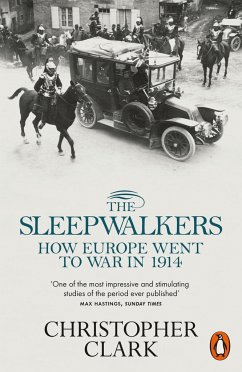 Christopher Clark: Die Schlafwandler Wie Europa in den ersten Weltkrieg zog
Christopher Clark: Die Schlafwandler Wie Europa in den ersten Weltkrieg zogChristopher Clark: The Sleepwalkers How Europe Went to War in 1914
Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine erinnerten mich wieder an dieses Buch, welches ich schon vor einiger Zeit gelesen habe. Auch wenn die Umstände heute ganz andere sind, so gibt es doch ein gemeinsames Element: Die Überraschung. Unähnlich zu 1914 ist, dass sich damals vor Allem die Herrschenden überrascht waren, heute sind wir da schon demokratischer: Wir haben verdrängt oder, milder gesagt, nicht vorhergesehen, dass es Feinde der Demokratie gibt und dass diese entsprechend agieren können und werden.
Das Buch erinnert uns prima daran, wohin das führen kann ...
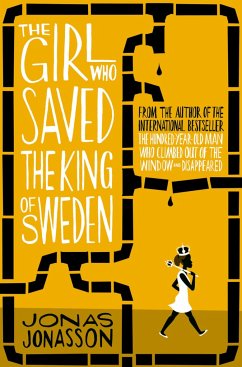
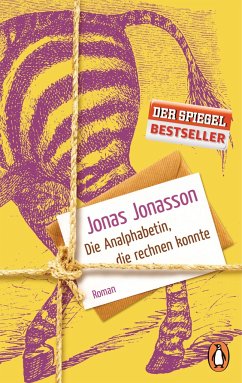 Jonas Jonasson: The Girl Who Saved the King of Sweden
Jonas Jonasson: The Girl Who Saved the King of SwedenJonas Jonasson: Die Analphabetin, die rechnen konnte
Übersetzungen von Buchtiteln ins Deutsche lassen einen manchmal staunen. Der deutsche Titel ist inhaltlich nicht wirklich falsch und ... bezogen auf den Inhalt des Buches sogar eigentlich noch spezifischer als der englische Titel. Wahrscheinlich hatte man hier die Befürchtung, dass sich in Deutschland niemand für Leute interessiert, die den schwedischen König retten.
Diese Geschichte der jungen Südafrikanerin Nombeko habe ich vor einigen Jahren gelesen. Ich fand die Geschichte skurril und lustig und sie geht, in Anbetracht dessen, was eine junge Südafrikanerin dieser Herkunft „normalerweise” für ein Leben zu erwarten hätte, für die Heldin erfrischend positiv aus.
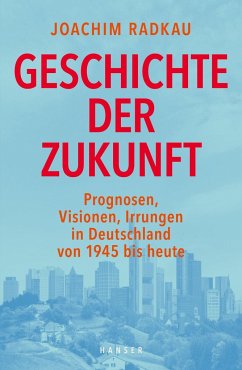 Joachim Radkau: Geschichte der Zukunft Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute
Joachim Radkau: Geschichte der Zukunft Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heuteJoachim Radkau beschreibt in chronologischer Abfolge, welche Prognosen von 1945 an bis heute so verbreitet wurden, welche korrekt waren, welche teilweise zutrafen und welche Utopie blieben.
In der dritten Grundschulklasse Ende der 60er-Jahre erklärte uns unser Klassenlehrer, dass wir gut dran seien, denn im Jahr 2000 müssten wir gar nicht mehr arbeiten, weil die Arbeit dann von Robotern erledigt werden würde. Etwa bei der Hälfte der Beispiele, die dieses spannende Buch darbietet, stellt sich ein ähnliches Gefühl ein, wie wenn ich heute über die Prognose meines Klassenlehrers nachdenke. „Schade!”, denke ich, „hat wohl (noch) nicht geklappt.”
Bei fast allen anderen Beispielen, die in dem Buch geschildert werden, denke ich „Gott sei Dank, dass das nicht so eingetreten ist!” Schon allein deswegen lohnt es sich das Buch zu lesen.
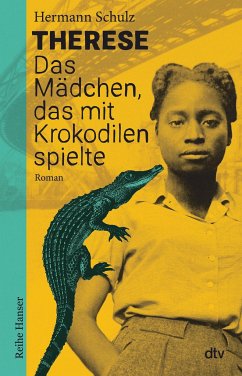 Hermann Schulz: Therese Das Mädchen, das mit Krokodilen spielte
Hermann Schulz: Therese Das Mädchen, das mit Krokodilen spielteDer Autor Hermann Schulz ist als Missionarssohn in Afrika zur Welt gekommen. 1977 besuchte er wieder Togo. Er war dort der einzige Weiße in einem Supermarkt und wurde zu seiner Überraschung von einer Frau in akzentfreiem Deutsch angesprochen. Diese Frau erzählte ihm, dass sie, wie er, aus Wuppertal komme, wo sie 1900 als Kind einer Völkerschautruppe aus der ehemaligen deutschen Kolonie Togo geboren wurde.
Das Buch erzählt die Geschichte dieser Frau namens Therese von 1900 bis zur der Machtergreifung Hitlers 1933, als ihr die Ausreise aus Deutschland in das ihr bis dahin völlig unbekannte Togo gelingt. Die Erzählung geht von Ihrem Aufwachsen in einer christlich geprägten Pflegeelternfamilie bis zu Ihrer letzten Tätigkeit in Deutschland als Leiterin eines Kinderheims in Hamburg.
„Bin ich eine Deutsche? Bin ich eine Afrikanerin? Diese Fragen würden sie noch viele Jahre beschäftigen, doch irgendwann würde sie wissen, dass die Frage unsinnig war” Ein sehr bemerkenswertes Buch....
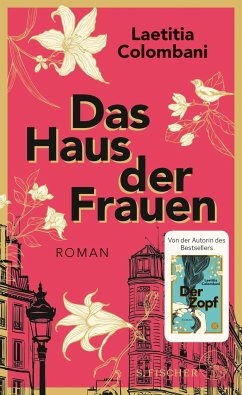 Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen
Laetitia Colombani: Das Haus der FrauenVor der Augen der Pariser Staranwältin Solène begeht ein Mandant Selbstmord. Solènes bisheriges Wertesystem erfährt dadurch einen Crash. Die junge Frau nimmt sich eine Auszeit. Eher durch Zufall (?) engagiert sie sich in einem Frauenhaus in Paris, welches in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts von Blanche Peyron, einer Vorkämpferin der Heilsarmee, erbaut worden war, damals eine völlige Novität.
Der Roman lebt davon, dass er perspektivisch zwischen dem Leben der Blanche Peyron und dem Leben der Staranwältin Solène hin- und herpendelt. Obwohl es Solène materiell ungleich besser geht als der Blanche Peyron 100 Jahre zuvor, wird im Roman deutlich, dass Sinn im Leben nur durch das Wagnis des sich Einlassen zustande kommt. Das ist immer noch schwer, heute wie damals. Das wie? wird in dem Buch spannend erzählt.
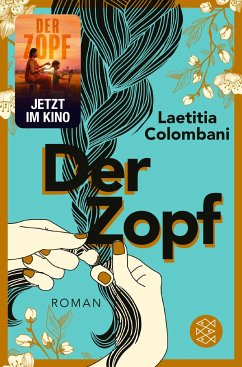 Laetitia Colombani:
Der Zopf
Laetitia Colombani:
Der ZopfDieses Buch hat bisher nur meine Frau gelesen. Sie fand es auch gut. Mehr kann ich bis jetzt nicht dazu sagen.
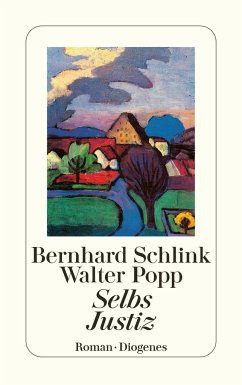
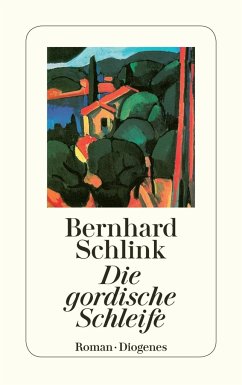
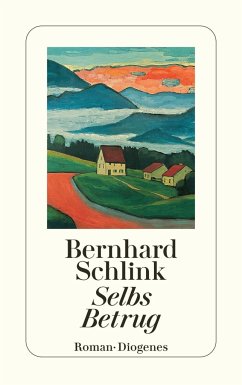
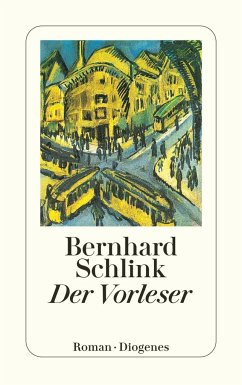
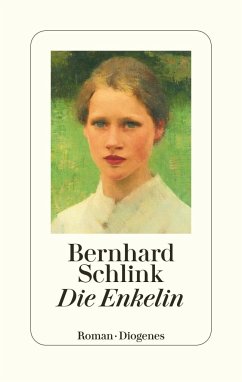 Bernhard Schlink, Walter Popp: Selbs Justiz,
Bernhard Schlink, Walter Popp: Selbs Justiz,Bernhard Schlink: Die gordische Schleife, Bernhard Schlink: Selbs Betrug, Bernhard Schlink: Der Vorleser, Bernhard Schlink: Die Enkelin
Das erste Buch, Selbs Justiz, habe ich vor über 30 Jahren gelesen. Selb, ein Jurist, der als junger Mann noch unter den Nazis als Richter Karriere gemacht hat, geht in der neuen Bundesrepublik neue Wege und arbeitet als Privatdetektiv. „Die Vergangenheit kann dich immer wieder einholen.” Was das mit den Menschen macht, zeigt dieses Buch auf faszinierende Weise.
Zum Geburtstag habe ich „Die Enkelin” geschenkt bekommen. Ein junger westdeutscher Student, besucht in den 60ern Ostberlin, wo er eine junge Studentin kennenlernt. Die beiden werden ein Paar. Der Student kratzt alle seine Ersparnisse zusammen und leiht sich Geld von Freunden, um die Fluchthelfer bezahlen zu können, die der jungen Frau die Flucht in den Westen ermöglichen, wo die Beiden heiraten.
Nach dem Tod seiner Frau erfährt der Mann, was diese im verschwiegen hat: Die Frau hat ihr leibliches Kind in der DDR zurückgelassen. Der Witwer macht sich auf die Suche nach der Tochter seiner Frau und findet nicht nur die Tochter, sondern auch deren Tochter, quasi seine Enkelin. Die beiden lernen sich im 2. Teil des Buches kennen. Das Problem: Der Ich-Erzähler, die Tochter seiner Frau und die „Enkelin” leben in ganz anderen Welten. Sie haben grundsätzlich andere Wertvorstellungen und sind sich so fremd, wie es nur sein kann. Dennoch finden „Enkelin” und der Ich-Erzähler zueinander... Mehr wird nicht verraten.
Auch die anderen 4 Bücher sind alle lesenswert!
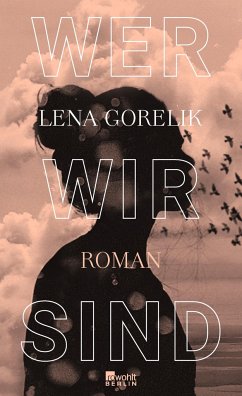 Lena Gorelik: Wer wir sind
Lena Gorelik: Wer wir sind» Wie die Erinnerung manchmal das Jetzt übertönt. Wie sie sich über alles legt, wie ein Dickicht aus Verletzungen, Mustern und Fragen. Wie ich nicht mehr weiß, wie ich wurde und wann. Und ich dennoch beginne zu erzählen. «
Diese Sätze stehen am Anfang von Lena Goreliks autobiographischem Roman, in dem sie schildert, wie sie, ihre Eltern, ihre Großmutter und ihr Bruder 1992 von Leningrad (heute: Sankt Petersburg) nach Deutschland, „in die Freiheit” kamen. Sie kamen als so genannte „jüdische Kontingentflüchtlinge”.
»„Das ist deine Geschichte”, sagt meine Mutter, als ich ihr diese Zeilen zeige.« Mit dem Satz endet das Buch.
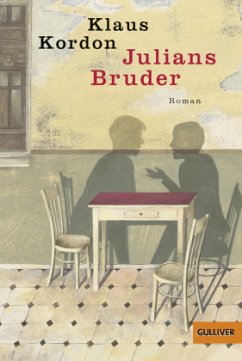 Klaus Kordon: Julians Bruder
Ich zitiere aus der nicht mehr zu sehenden Buchbesprechung auf buecher.de:
Klaus Kordon: Julians Bruder
Ich zitiere aus der nicht mehr zu sehenden Buchbesprechung auf buecher.de:»Paul und Julian wachsen im Berlin der 30er-Jahre wie Brüder auf. Den Nationalsozialismus überlebt Julian in Verstecken: Er ist Jude. Nach dem Krieg könnte für die beiden ein neues Leben beginnen, doch schon nach wenigen Tagen Frieden werden sie verhaftet und kommen in ein sowjetisches Internierungslager - das ehemalige KZ Buchenwald.«
Klaus Kordon (geboren 1943) ist ja kein Zeitzeuge. Aber er beschreibt die Zeit so plastisch, wie es wahrscheinlich ein Zeitzeuge nicht hinbekommen würde. Ich habe das Buch von einer Freundin ausgeliehen bekommen, nachdem wir uns darüber unterhalten hatten, wie nach dem 2. Weltkrieg auch die Besatzungszeit die Menschen im Osten zusätzlich traumatisiert haben muss.
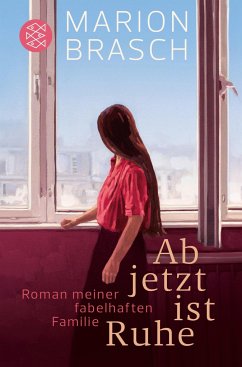 Marion Brasch: Ab jetzt ist Ruhe Roman meiner fabelhaften Familie
Marion Brasch: Ab jetzt ist Ruhe Roman meiner fabelhaften Familie„Im Osten waren die Widerstände aus Beton. Im Westen sind sie aus Gummi.” beklagt sich der in den Westen ausgereiste älteste Bruder der Autorin, als sie sich heimlich in Budapest treffen.
Der Vater von Marion Brasch, dem zur Nazizeit die Flucht ins Londoner Exil gelang, kehrte aus dem Exil nach Ost-Berlin zurück, wo er seinem neuen Ideal, dem Sozialismus dienen wollte. Die Mutter der Autorin, eine aus Wien stammende Jüdin, die er im Exil geheiratet hatte, wollte nicht in die DDR und folgte ihm deshalb erst später nach. Keines der vier Kinder des Paares teilte die Ideale des Vaters: Der Älteste, ein Schriftsteller, ging in den Westen, weil er im Osten sein Buch nicht veröffentlichen konnte. Sein SED-Funktionärs-Vater wurde deswegen abgestraft, indem er auf eine minder wichtige Stelle, in die Provinz, nach Karl-Marx-Stadt versetzt wurde.
Was die anderen drei gemacht haben, wird hier nicht verraten, aber eines ist klar: Das Buch lebt von den mutigen Menschen, die gegen alle Widerstände in dem Land, welches es nicht mehr gibt, ihren Weg gegangen sind.
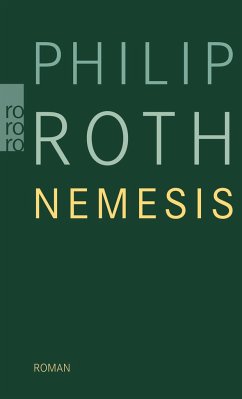 Philip Roth: Nemesis
Philip Roth: Nemesis2012 erschien das Buch Philip Roths über die Polio-Epidemie in den USA im zweiten Weltkrieg, als es noch kein Gegenmittel gegen Polio gab, ja als noch nicht einmal klar war, wie sich Polio verbreitete.
Der 23-jährige Sport-Lehrer arbeitet in einem gut bürgerlichen jüdischen Viertel in der Stadt Newark. Er bedauert, dass er wegen eines Seh-Fehlers eine Brille benötigt und deshalb nicht so, wie seine anderen Altersgenossen zur Armee eingezogen worden war. Trotzdem ist er ein brillianter Sportler, unter Anderem Schwimmer und Turmspringer. Er erkrankt selbst an Polio. Wieder genesen, kann er sein linkes Bein und seinen linken Arm nicht mehr richtig bewegen. Mit seinem Sportler-Dasein ist Schluss. Nichts von dem, was ihm im Leben wichtig war, geht noch.
Er kommt nicht mehr in sein altes Leben zurück, er wendet sich von seiner Verlobten ab und erlaubt nicht mehr, dass seine Verlobte ihn heiratet. Er sieht sein Leben entwertet und denkt er wäre nun eine Zumutung für sie.
Mindestens genau so schlimm, wie die Entwertung seines Lebens durch die Krankheit ist die Selbstentwertung, die er vornimmt. Ein Phänomen, das wir heute auch bei Corona-Genesenen beobachten können. Die Krankheit zerstört immer mehr als nur die körperlichen Fähigkeiten. Insofern ist das ein hochaktuelles Buch....
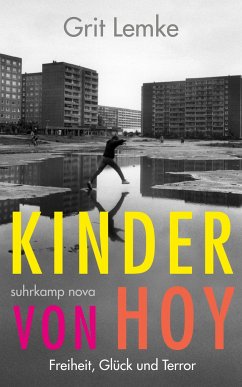 Grit Lemke: Kinder von Hoy
Freiheit, Glück und Terror
Grit Lemke: Kinder von Hoy
Freiheit, Glück und TerrorFür uns Wessis gilt Hoyerswerda seit den rechtsradikalen und rassistischen Vorfällen der Nachwendezeit als der Un-Ort im Osten schlechthin. ... Und jetzt schreibt diese Autorin genau darüber ein Buch! Aber was für eins! Grit Lemke, die in 60er-Jahren nach Hoyerswerda gekommen ist, verknüpft autobiographisches Material mit den Erzählungen anderer „Kinder von Hoy”. Sie erzählt vom Leben in der DDR-Musterstadt von ihrer Kindheit und Jugend bis zu den Tagen der Nachwendezeit in dieser Stadt. In meinen Augen ein sehr ehrliches Buch, das nichts beschönigt und das einem gerade deshalb die Geschichte dieser Stadt und ihrer Bewohner nahe bringt.
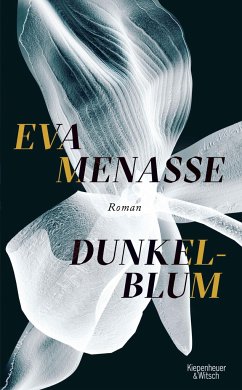 Eva Menasse: Dunkelblum
Eva Menasse: DunkelblumDunkelblum ist ein fiktiver Ort in Österreich nahe der Grenze zu Ungarn. Im Sommer 1989 warten Hunderte von DDR-Flüchtlingen hinter Grenze. Ein Skelett wird gefunden und die Bewohner des Städtchens beginnen sich an eine alte Schuld zu erinnern.
Das Buch lebt davon, dass man sich nicht über die Menschen von Dunkelblum erheben kann. Stattdessen stellt sich der Leserin/dem Leser die Frage: „Wie hätte ich mich in so einer Situation verhalten?”

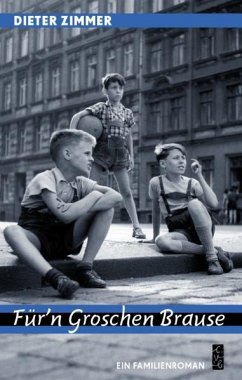 Uwe Tellkamp: Der Turm Geschichte aus einem versunkenen Land
Uwe Tellkamp: Der Turm Geschichte aus einem versunkenen LandDieter Zimmer: Für'n Groschen Brause Ein Familienroman
Als das Buch von Uwe Tellkamp im Jahr 2006 erschien und auch als es verfilmt wurde, habe ich es nicht zur Kenntnis henommen. In einer Besprechung auf www.buecher.de wurde es einmal so beschrieben: „Ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben.” → Ja, stimmt!
Das Buch von Dieter Zimmer lag im Urlaub in unserer Unterkunft. Während der Roman von Uwe Tellkamp eine Innensicht aus der Welt kurz vor dem Ende der DDR zeichnet, geht es in dem offensichtlich stark autobiographisch orientierten Bericht um die Anfänge der DDR in den 50er-Jahren. Der Autor schildert plastisch, wie man sich als junger Mensch damals in der Gesellschaft zurechtfinden musste. Was konnte man wem anvertrauen und sagen und an welchen Werten orientierte man sich?
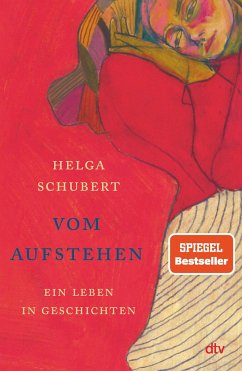 Helga Schubert: Vom Aufstehen Ein Leben in Geschichten
Helga Schubert: Vom Aufstehen Ein Leben in GeschichtenHelga Schubert ist auf den Tag genau 20 Jahre älter als ich. Was ich aus ihrem Buch herausspüre, ist Altersweisheit, wie ich sie auch gerne haben möchte und Versöhntsein mit den schwierigen Seiten des Lebens. Keine billige Zufriedenheit, nein, versöhnt sein ist Ergebnis einer Auseinandersetzung mit all dem, womit wir zunächst einmal nicht einverstanden sein können. Auseinandersetzung so, dass wir bei uns bleiben können und etwas vom Leben haben. Wie das gehen kann, zeigt sie uns in 29 Geschichten aus ihrem Leben.
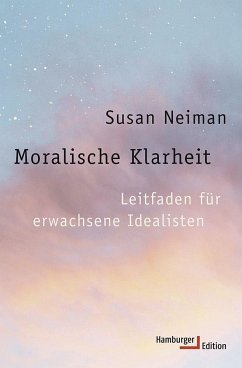 Susan Neiman: Moralische Klarheit Leitfaden für erwachsene Idealisten
Susan Neiman: Moralische Klarheit Leitfaden für erwachsene IdealistenEines der Verdienste des Buches von Susan Neiman ist es, an vielen Beispielen aufzuzeigen, wie die eigene Haltung zu moralischen Fragen durch die eigene soziale Stellung, die jeweilige Herkunft geprägt wird. Wer unter prekären Arbeitsbedingungen im alltäglichen Gerangel um Jobs steht wird das anders sehen, wie jemand der in gesicherten wohlhabenden Verhältnissen, z. B. als Arzt, sein geregeltes Einkommen hat. Jemand, der in einem Bürgerkriegsland aufwächst, wo keine staatliche Macht für Recht und Ordnung sorgt, wird Moral ganz anders definieren, wie jemand der mit einer stabilen Rechtsordnung aufwächst, sei diese autoritär ideologisch oder liberal geprägt. Susan Neiman zeigt auf, dass moralische Werte nicht einfach aus vorgegebenen Regeln ableitbar sind. Moralische Werte setzen ein individuelles Nachdenken voraus und entspringen aus der Übernahme von Verantwortung in einer gegebenen Situation.
Das Buch ist so super, weil es mir die Augen geöffnet hat, wie meine Eltern- und meine Großeltern-Generation ihr moralisches Gerüst durch ihre jeweilige Lebenssituation geprägt mitbekommen und mitgenommen haben. Auf den ersten Blick erscheint das trivial, aber die Qualität des Buches besteht darin, diesen Zusammenhang genauer und detaillierter aufzuzeigen und obendrein die klassische Ethik mitzudiskutieren.

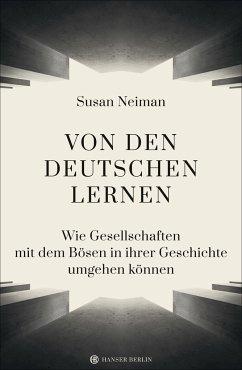
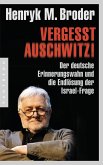 Susan Neiman: Learning from the Germans Confronting Race and the Memory of Evil
Susan Neiman: Learning from the Germans Confronting Race and the Memory of EvilSusan Neiman: Von den Deutschen lernen Wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können
Henryk M. Broder: Vergesst Auschwitz! Der deutsche Erinnerungswahn und die Endlösung der Israel-Frage
Für uns Deutsche bringt Susan Neimans Buch einen radikalen Perspektivwechsel: Susan Neiman, eine US-Amerikanerin mit jüdischen Wurzeln, schreibt dieses Buch für ihre Landsleute. Sie zeigt auf, was an der deutschen Vergangenheitsbewältigung nach dem dritten Reich ihrer Meinung nach richtig gelaufen ist. Ausgehend von der Nachkriegssituation gelingt es ihr, díe „Schuld” der Deutschen zu benennen.
Ich konnte schon immer verstehen, dass die Menschen meiner Großelterngeneration, die, selbst wenn sie den Nazis nahestanden, den Krieg, wie ihn Hitler dann angezettelt hat, nie gewollt hatten, sich dann am Ende des Krieges, wenn sie ihre Heimat oder ihnen nahestehende Personen verloren hatten, als Opfer fühlten.
Es ist und war die Stärke des Prozesses der „Vergangenheitsbewältigung”, dass diese Menschen oder deren Nachkommen, sich dennoch für die Folgen des Rassismus, die Folgen der rassistischen Haltungen, verantwortlich erklärten.
Das Buch startet auch mit der klaren Aussage, dass Rassismus in den Südstaaten der USA und der Rassismus im 3.Reich letztlich als solche nicht vergleichbar sind. Sie zeigt aber auf, wie wir die Art und Weise, wie in den jeweiligen Ländern dem Rassismus begegnet wird, sehr wohl vergleichen können. Es gelingt Susan Neiman die Unterschiede im Umgang mit der jeweils eigenen Geschichte aufzuzeigen. Für mich ein faszinierendes Buch, weil es auch die eigenen blinden Flecken ausleuchtet.
Den Gegenpart zu Susan Neiman liefert Henryk Broders Buch. Im Gegensatz zu ihr stellt er den Umgang mit dem Antisemitismus in Deutschland als gänzlich gescheitert dar. Er beschreibt das Andenken an Auschwitz und an die Shoa wie eine Krankheit, die die Deutschen befallen hat: Eine Krankheit, die das Gegenteil von dem bewirkt, was sie zu bewirken vorgibt, die den Antisemitismus stärkt statt schwächt.
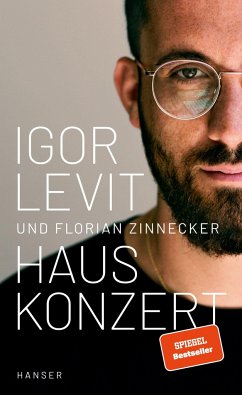 Igor Levit und Florian Zinnecker: Hauskonzert
Igor Levit und Florian Zinnecker: HauskonzertDas Buch ist keine Literatur im klassischen Sinne. Das Buch ist kein Roman. Es ist eher ein Tagebuch, welches die Gedanken des erfolgreichen Pianisten Igor Levit darlegt. Igor kam 1985 mit seinen Eltern nach Deutschland, als die Bundesrepublik jüdischstämmigen Menschen aus der Sowjetunion als "Kontingentjuden" die Einreise nach Deutschland erlaubte. Seine Eltern entschlossen sich zu diesem Schritt, weil sie wollten, dass ihre Kinder es „einmal besser haben” sollten. Igor Levit ist als Künstler und Musiker anerkannt und geschätzt. In dem Augenblick, wo er es sich aber erlaubt vor seinem Konzert dem Publikum seine Gedanken über das „besser” darzulegen, da scheiden sich die Geister!
An einer Stelle im Buch schreibt er dazu:
»Nach jeder rassistischen Attacke, nach jedem Anschlag gibt es mindestens einen Politiker, der sagt:›Damit das klar ist, in unserem Land gibt es keinen Platz für Rassismus‹. Es gibt aber eine Menge Platz für Rassismus, leider gab es immer Platz dafür. Begreift das! Hört auf, Nebelkerzen zu werfen, hört auf zu reden, als wären wir fünf Jahre alt! Sprecht aus, was ist: Wir haben ein sehr ernstes Problem mit Rassismus und Antisemitismus. Wir sollten mit unserer Sprache ein bisschen erwachsener werden.«
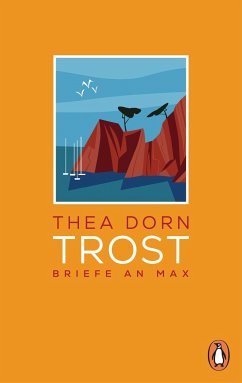 Thea Dorn: Trost Briefe an Max
Thea Dorn: Trost Briefe an MaxDas Buch enthält einen Briefwechsel zwischen einer Frau, deren Mutter an Corona verstarb, und einem alten Freund. Die Mutter wird beschrieben als lebenslustige selbstständige Frau, die eine Künstleragentur betrieb und mit bei Beinen voll im Leben stand. Wegen Corona nicht verreisen? → Nein! Kontakte deswegen einschränken? → Nein! Was soll das Alles? So kommt die Mutter rüber. Sie stirbt an den Folgen der Covid-Infektion. Die Tochter hatte keine Möglichkeit sich von Ihrer Mutter zu verabschieden.
Thea Dorn, wohl das alter Ego der Protagonistin, lässt es krachen. Mit Ihrer ganzen Intellektualität befragt sie sich selbst und all Ihr Wissen und räsoniert, wie ..., wo ..., auf welche Weise sie in dieser Situation Trost refahren könnte. Thea Dorn lässt nichts aus: Religion, Gott, die antiken, die neuzeitlicheren Philosophen, deren „Trost” tröstet sie nicht. Am Ende des Buches wird deutlich, Trost ist teuer. Er kann das Leben kosten. Und nur, wenn ich mich ehrlich auf den Weg mache und mir klar mache, was für mich wirklich wichtig ist im Leben, kann ich so etwas wie Trost erfahren.
Ein unmögliches Buch! Ich bin froh, dass ich's gelesen habe.
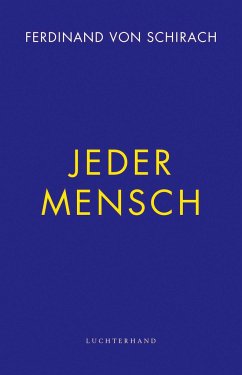 Ferdinand von Schirach: Jeder Mensch
Ferdinand von Schirach: Jeder MenschIn einem Artikel der aktuellen Ausgabe der Zeit wird aufgezeigt, wie Ferdinand von Schirach versucht die Grundrechte der Menschen neu zu formulieren. Sein Ziel: Eine Debatte über die Gestalt einer aktuellen Version der menschlichen Grundrechte.
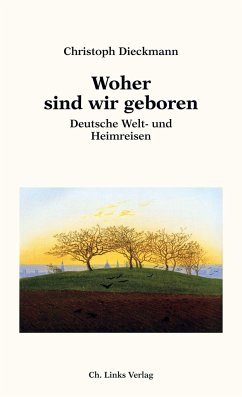 Christoph Dieckmann: Woher sind wir geboren
Christoph Dieckmann: Woher sind wir geborenMit offenem Mund liest man nochmal (man erinnert sich wieder dunkel, dass man es schon einmal mit Staunen vernommen hat) wie am 20. und 21. Januar 1990 eine vom vorausgegangenen Sonderparteitag der SED eingesetzte Schiedskommission praktisch die ganze DDR-Führungsriege in einem Akt pseudoselbstkritischer Inszenierung aus der Partei warf. Letztlich war das ein Akt panischer Selbstenthauptung der DDR-Führung, nachdem dieser durch eine Schusselei von Schalk-Golodkowski die Mauer, eine der wesentlichen Grundlagen ihrer Macht, weggebrochen war.
Es gelingt Christoph Dieckmann mit einer Vielzahl an (auto-)biographischen Episoden deutlich zu machen, wie unterschiedlich, aber auch wie ähnlich die Zeiten die Menschen in Ost und West geprägt haben. Darin liegt für einen Wessi wie mich der unschätzbare Wert des Buches.
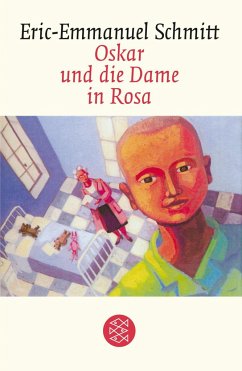
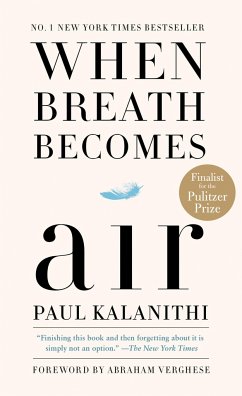 Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar und die Dame in Rosa
Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar und die Dame in RosaPaul Kalanithi: When Breath Becomes Air
Zwei Bücher über und von Menschen über die Zeit vor ihrem Tod, wo sie schon wissen, dass sie sterben werden:
„Nur der liebe Gott darf mich wecken.” steht während der letzten drei Tage seines Lebens auf einem Schild auf dem Nachttisch des 10-Jährigen unheilbar an Krebs erkrankten Oskar. Es ist die ‚‚Dame in Rosa‘‘, die Oskar beisteht, als seine Eltern dazu nicht mehr in der Lage sind, weil sie es nicht aushalten, dass ihr Kind dem Tode geweiht ist. Weder sie noch Dr. Düsseldorf, der behandelnde Arzt, haben die richtigen Worte, die Oskar jetzt braucht. 13 Briefe an den lieben Gott schreibt Oskar. Eric-Emmanuel Schmitt gelingt in dem Buch eine tieftraurige Geschichte, die der Trauer Raum gibt und es den Leser(inne)n möglich macht, sich bei all dem Schrecken Oskar ganz nahe zu fühlen.
Trotz aller Intellektualität gelingt es auch Paul Kalanithi eine Nähe herzustellen. Mit 36 Jahren hat er seine Ausbildung zum Neurochirurgen fast abgeschlossen. Ein inoperables Lungenkarzinom beendet seine steile Karriere radikal. Er beschreibt in seinem Buch den Rollenwechsel vom Medizinstudenten zum anerkannten und geschätzten Arzt und dann zum Patienten. Er stellt sich der Frage was noch bleibt, wenn alles wegfällt, was das Leben bedeutsam gemacht hat und was noch bleibt, wenn das Leben selbst zu Ende geht. Ein unglaubliches Buch.
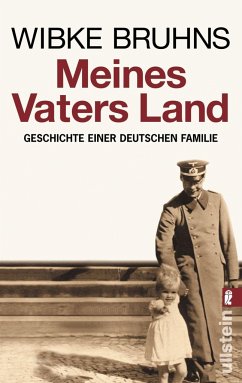 Wibke Bruhns: Meines Vaters Land Geschichte einer deutschen Familie
Wibke Bruhns: Meines Vaters Land Geschichte einer deutschen FamilieWibke Bruhns Vater war hochdekorierter Offizier im ersten und im zweiten Weltkrieg. Wibke Bruhns war 6 Jahre alt, als ihr Vater nach dem Attentat auf Hitler im Juli 1944 verhaftet wurde. Er wurde aus der Wehrmacht ausgestoßen, damit er als Zivilist vor Freislers Volksgerichtshof gestellt werden konnte (Die militärische Gerichtsbarkeit war dem Naziregime da zu unzuverlässig.). Er wurde zum Tod durch den Strang verurteilt, weil er von den Attentatsplänen auf Hitler gewusst hatte und die Attentäter und ihre Helfer (sein Vetter 2. Grades und Ehemann seiner Tochter hatte den Sprengstoff für das Attentat beschafft.) nicht verraten hat.
1987 stieß die Autorin auf Filmmaterial, in dem Ihr Vater vor dem Volksgerichtshof zu sehen ist. Da begann sie die Geschichte ihres Vaters zu recherchieren. Resultat ihrer Recherche ist dieses beeindruckende Buch.
Sie zeigt Verständnis für Ihre Mutter in dem Resümee: „Heute weiß ich, daß viele der 20.-Juli-Witwen gegenüber ihren Kindern geschwiegen haben. Es war ein Schweigen, wo Fragen sich verbot. Die Zumutung wurde von beiden Seiten vermieden.”
Dieses Schweigen über ihre (anfängliche ?) Begeisterung über das 3. Reich und das, was das nach dem 2. Weltkrieg mit Ihnen gemacht hat, habe ich in meiner Kindheit und Jugend immer dann bei den Anderen wahrgenommen, wenn Einzelne dann doch einmal über diese Zeit gesprochen und berichtet haben. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum mich das Buch so fasziniert.
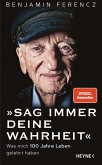 Benjamin Ferencz: Sag immer Deine Wahrheit
Benjamin Ferencz: Sag immer Deine Wahrheit„Benjamin Ferencz blickt auf 100 Jahre eines bemerkenswerten Lebens zurück. Er war Chefankläger in den Nürnberger Prozessen nach dem 2. Weltkrieg. Unermüdlich hat er sich für eine gerechte und friedliche Welt eingesetzt.” Später war er dabei, als in Den Haag der internationale Gerichtshof für Menschenrechte eingerichtet wurde.
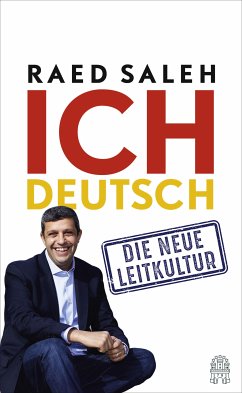 Raed Saleh, Markus Frenzel (Co-Autor): Ich deutsch Die neue Leitkultur
Raed Saleh, Markus Frenzel (Co-Autor): Ich deutsch Die neue LeitkulturRaed Saleh kam als Fünf-Jähriger von Palästina nach Deutschland. Wenn es so etwas gibt, wie „gelungene Integration” in der neuen Heimat, dann ist Raed Saleh das beste Beispiel dafür.
Mit dem Titel „Ich deutsch” kokettiert er mit dem Vorurteil, dass Menschen mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache unvollkommen beherrschen und damit eigentlich nicht in der Lage sind, die deutsche Kultur vollkommen zu verstehen, und etwas Adäquates dazu zu sagen. Er plädiert für eine neue deutsche Leitkultur, die nicht mehr die Augen vor den aktuellen Entwicklungen verschließt. An vielen interessanten Beispielen skizziert er, wie so eine neue Leitkultur seiner Meinung nach aussehen müsste.
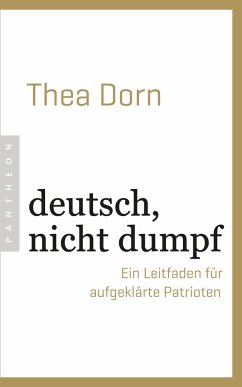 Thea Dorn: deutsch, nicht dumpf Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten
Thea Dorn: deutsch, nicht dumpf Ein Leitfaden für aufgeklärte PatriotenThea Dorn geht es letztlich auch um das, was Leitkultur sein könnte. Sie reflektiert, was passiert, wenn jeder unter „Deutschland” etwas Anderes versteht. Wo bleibt dann das „wir”?
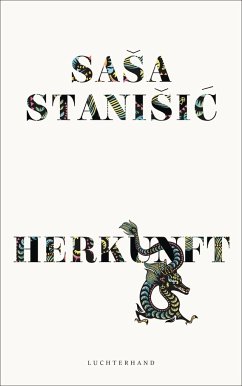 Sasa Stanisic:
HERKUNFT
Sasa Stanisic:
HERKUNFTWoher kommen wir und was hat das für Folgen für das hier und jetzt.
Man erfährt viel über das ehemalige Jusoslawien und doch viel über uns.
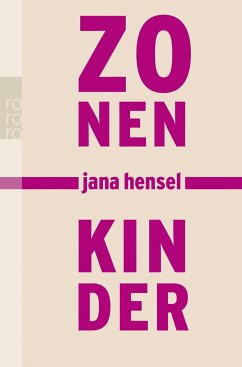

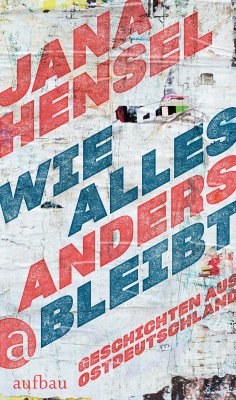
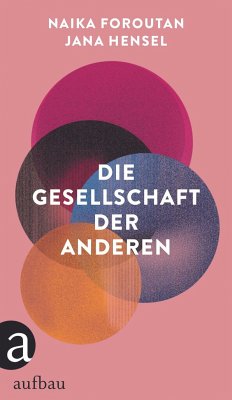 Jana Hensel: Zonenkinder
Jana Hensel: ZonenkinderJana Hensel, Wolfgang Engler: Wer wir sind Die Erfahrung Ostdeutsch zu sein
Jana Hensel: Wie alles anders bleibt
Naika Foroutan, Jana Hensel: Die Gesellschaft der Anderen
Letztlich waren das für mich wichtige Bücher, die mir als Wessi geholfen haben die „Ostdeutschen” besser zu verstehen.
Das neueste Buch, „Die Gesellschaft der Anderen” handelt davon, dass Ostdeutsche und Migranten zusammen 50% der Bevölkerung der Bundesrepublik stellen. Beide Gruppen sind in den Entscheidungsgremien des Landes deutlich unterrepräsentiert. Jana Hensel und Naika Foroutan diskutieren das in einer Art „Streit“schrift.
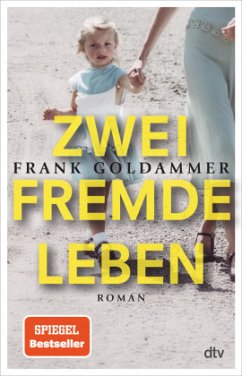 Frank Goldammer: Zwei fremde Leben
Frank Goldammer: Zwei fremde LebenEinmal kein Krimi von dem ansonsten als Krimi-Autor bekannten Frank Goldammer. Frank Goldammer beschreibt sein Buch als „Spurensuche”. Es geht um die Frage inwieweit die DDR als Staat verantwortlich war für Kindsentführungen und Zwangsadoptionen.
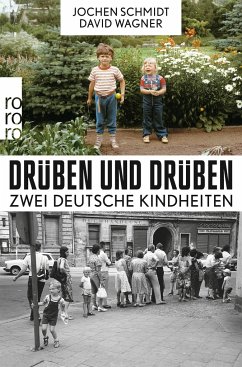 Jochen Schmidt, David Wagner: Drüben und drüben Zwei deutsche Kindheiten
Jochen Schmidt, David Wagner: Drüben und drüben Zwei deutsche KindheitenZwei Anfang der 70er-Jahre geborene Schriftsteller, ein Ossi, ein Wessi, beschreiben ihre Kindheit. Beiden wird gesagt, „Drüben” sei die Welt schlechter. Gerade in dieser Gegenüberstellung ein faszinierendes Buch...
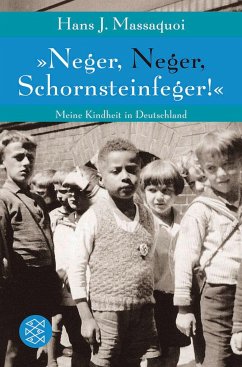 Hans J. Massaquoi: »»Neger, Neger, Schornsteinfeger!« Meine Kindheit in Deutschland
Hans J. Massaquoi: »»Neger, Neger, Schornsteinfeger!« Meine Kindheit in DeutschlandHans J. Massaquoi beschreibt in seiner außergewöhnlichen Autobiographie seine Kindheit und Jugend zwischen 1926 und 1948 als einer der wenigen schwarzen Deutschen in diesem Land.
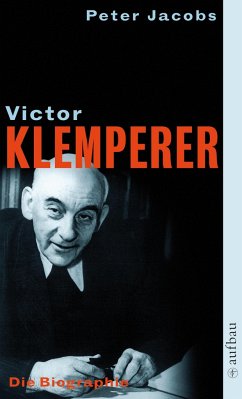 Peter Jacobs: Victor Klemperer, Im Kern ein deutsches Gewächs Eine Biographie
Peter Jacobs: Victor Klemperer, Im Kern ein deutsches Gewächs Eine BiographieEine Biographie über den berühmten Autor der Schrift Die Sprache des Dritten Reiches. Beobachtungen und Reflexionen aus LTI (LTI= ‚‚Lingua tertii imperii’’ → auf deutsch:‚‚Sprache des dritten Reiches’’). Aus meiner Sicht ist die Latinisierung des Ausdrucks "Drittes Reich" eine Art sprachliche Distanzierung des Autors, um die von der Nazi-Propaganda geliebte Bezeichnung vermeiden zu können.
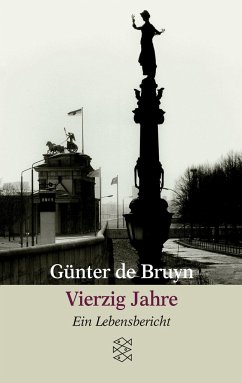 Günter de Bruyn: Vierzig Jahre - Ein Lebensbericht
Günter de Bruyn: Vierzig Jahre - Ein LebensberichtGünter de Bruyn berichtet in seiner Autobiographie über 40 Jahre Leben in der DDR. Das Besondere daran ist, dass er sehr ehrlich aufzeigt, welche ‚‚Kompromisse’’ und welche Verbiegungen ein solches Leben mit sich bringt. Er tut das so ehrlich, dass man gezwungen ist sich zu fragen, „Wie hätte ich mich in dieser Situation verhalten. Hätte ich die Kraft gehabt Unrecht zu widerstehen oder hätte auch ich mich auf irgendwelche ‚‚Kompromisse’’ eingelassen?”
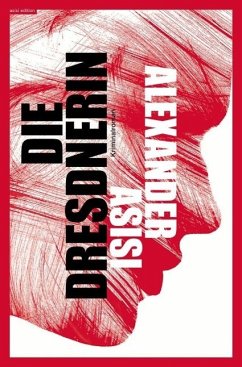 Alexander Asisi: DIE DRESDNERIN
Alexander Asisi: DIE DRESDNERINDer Neffe von Yadegar Asisi hat einen Krimi herausgebracht. Der Krimi spielt in der Zeit des Kriegsendes in Dresden, im Februar 1945, zur Zeit der großen Bombardierung der Stadt. Das ist kein Zufall, schließlich hat der Onkel des Autors die Bombardierung im Panometer in Dresden bildlich zur Darstellung gebracht. Von den Recherchen zu diesem Ereignis hat Alexander Asisi manches mitbekommen. Das tat dem Buch gut: Alles in Allem ein spannender Krimi.
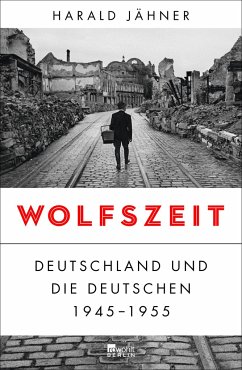 Harald Jähner: Wolfszeit Deutschland und die Deutschen 1945 - 1955
Harald Jähner: Wolfszeit Deutschland und die Deutschen 1945 - 1955Wenn ich einen völlig falschen Eindruck von dem Buch erwecken möchte, könnte ich schreiben „Noch so ein Nachkriegsbuch”... Ja, aber was für ein faszinierend Geschriebenes. Für mich gab es einen Einblick in das Denken und Fühlen der Menschen in den 50er-Jahren, den ich vorher so nicht hatte.
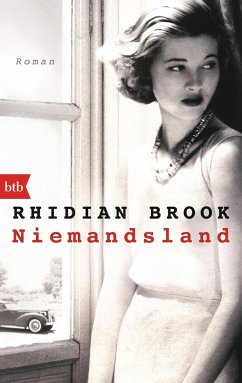 Rhidian Brook: Niemandsland
Rhidian Brook: NiemandslandDie Enkelin schreibt ein bewegendes Buch über die Zeit um 1946, als ihr Großvater Offiier der englischen Besatzungsarmee in Hamburg war.
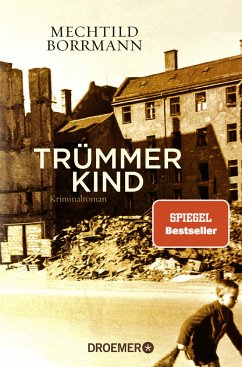 Mechtild Borrmann: Trümmerkind
Mechtild Borrmann: TrümmerkindEin Kriminal- und zugleich historischer Roman und eine Familiengeschichte, die in der Zeit im Jahrhundertwinter 1946/47 spielt. Wirklich ein Buch, das sich zu lesen lohnt. Es fällt schon auf, dass es in letzter Zeit immer mehr Bücher gibt. die sich mit der unmittelbaren Nachkriegszeit beschäftigen. Die Bücher werden ja gekauft (Offensichtlich auch von mir!). Es scheint in unserer Gesellschaft gerade ein neues Bedürfnis zu geben, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen.
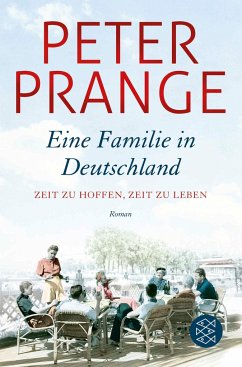
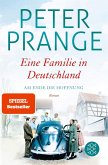 Peter Prange: Eine Familie in Deutschland
Peter Prange: Eine Familie in Deutschland
Band 1 → Zeit zu hoffen, Zeit zu leben
Band 2 → Am Ende die Hoffnung
Es handelt sich um die Geschichte einer Familie in der Zeit des 3. Reiches. Band 1 erzählt die Zeit von der Machtergreifung der Nazis bis kurz vor dem September 1939 und Band 2 erzählt die Geschichte während des 2. Weltkriegs bis 1955.
Für uns nach dem 2. Weltkrieg Geborene ein erschreckender Einblick, wie Ideologie von der Überlegenheit der arischen Rasse nach und nach alle moralischen Werte und letztlich auch jeglichen Gemeinsinn korrumpiert, so dass sich jeder selbst der Nächste ist.
Die folgende Überlegung hat nichts unmittelbar mit dem Buch zu tun, drängte sich mir aber, nachdem ich die beiden Bände gelesen hatte doch auf:
Ich glaube, dass die Erfahrungen des 2. Weltkriegs zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, noch in dem Sinne nachgewirkt haben, dass damals bei der Mehrheit der Bevölkerung ein, wenn auch schwaches, so doch klares Gefühl vorhanden war, dass so etwas nicht mehr passieren darf und dass Alle an Bildungschancen und an den materiellen und kulturellen Gütern teilhaben müssen, damit eine Gesellschaft funktioniert. Dieses Bewusstsein, wie gefährlich so eine Desintegration der gesellschaftlichen Gruppen ist, fehlt heute.
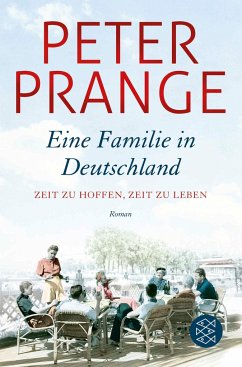
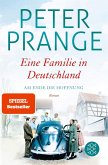 Peter Prange: Eine Familie in Deutschland
Peter Prange: Eine Familie in DeutschlandBand 1 → Zeit zu hoffen, Zeit zu leben
Band 2 → Am Ende die Hoffnung
Es handelt sich um die Geschichte einer Familie in der Zeit des 3. Reiches. Band 1 erzählt die Zeit von der Machtergreifung der Nazis bis kurz vor dem September 1939 und Band 2 erzählt die Geschichte während des 2. Weltkriegs bis 1955.
Für uns nach dem 2. Weltkrieg Geborene ein erschreckender Einblick, wie Ideologie von der Überlegenheit der arischen Rasse nach und nach alle moralischen Werte und letztlich auch jeglichen Gemeinsinn korrumpiert, so dass sich jeder selbst der Nächste ist.
Die folgende Überlegung hat nichts unmittelbar mit dem Buch zu tun, drängte sich mir aber, nachdem ich die beiden Bände gelesen hatte doch auf:
Ich glaube, dass die Erfahrungen des 2. Weltkriegs zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, noch in dem Sinne nachgewirkt haben, dass damals bei der Mehrheit der Bevölkerung ein, wenn auch schwaches, so doch klares Gefühl vorhanden war, dass so etwas nicht mehr passieren darf und dass Alle an Bildungschancen und an den materiellen und kulturellen Gütern teilhaben müssen, damit eine Gesellschaft funktioniert. Dieses Bewusstsein, wie gefährlich so eine Desintegration der gesellschaftlichen Gruppen ist, fehlt heute.
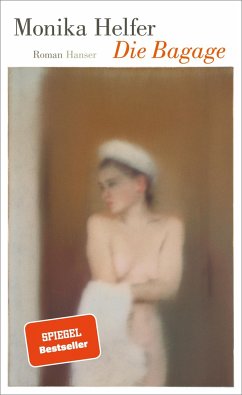 Monika
Helfer: Die Bagage
Monika
Helfer: Die BagageÖsterreich, Vorarlberg, zur Zeit des ersten Weltkrieges: Josef Moosbrugger und seine überaus schöne Frau Maria leben mit ihren Kindern am Rand eines Bergdorfes. Sie sind arm und wohnen oben am Berghang. Dennoch schauen die Dorfbewohner auf die Familie herab und titulieren die Familie als „Bagage”.
Als Josef Moosbrugger zum Militär muss, bittet er den Bürgermeister als Beschützer seiner Frau und seiner Kinder zu fungieren. Als er aus dem verlorenen Krieg zurückkommt, verdächtigt er seine Frau, dass eines seiner Kinder nicht von ihm stammt.
Ein spannendes Buch darüber, wer in der Gesellschaft anerkannt ist und wer nicht und was das mit den Menschen macht. Nicht zuletzt geht's nebenbei auch darum, dass der härteste Sex eben eher in der Phantasie der Leute stattfindet als in der Realität.
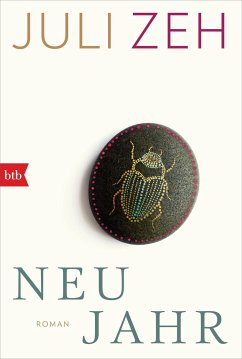 Juli Zeh: Neujahr
Juli Zeh: NeujahrJuli Zehs neuer Roman „Neujahr” kreist um eine Figur, die in der Literatur noch recht ungewöhnlich ist: um den überforderten Vater.
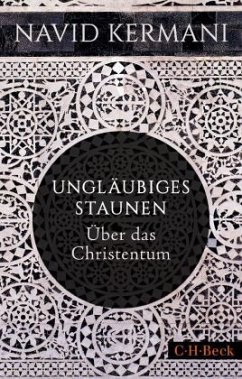 Navid Kermani: Ungläubiges Staunen Über das Christentum
Navid Kermani: Ungläubiges Staunen Über das ChristentumNoch nie habe ich von einem Autor, der selbst Moslem ist, Tiefgründigeres über das Christentum lesen können. Als evangelischer Christ in theologischen Fragen nicht gerade unbewandert, konnte ich noch etwas über das Christentum lernen. Zugleich zeigt das Buch Wege auf, wie Moslems und Christen zueinander finden können. Navid Kermanis schafft quasi eine „Innenansicht des Christentums von außen”! → Sehr zu empfehlen!
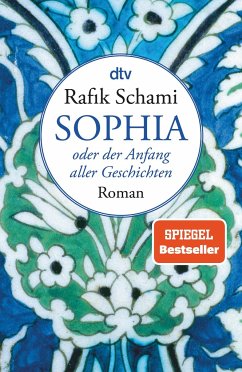
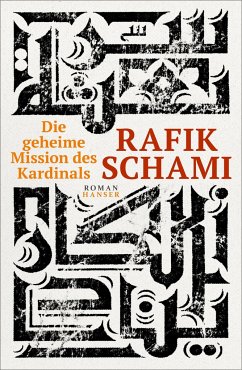
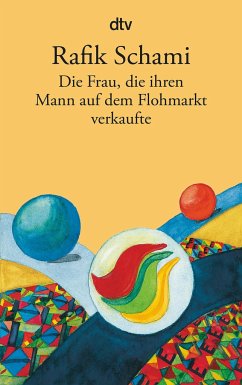
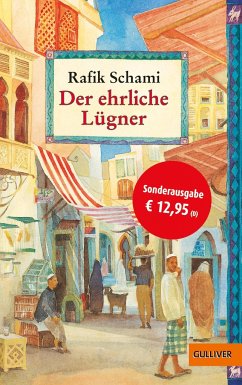 Rafik Schami: Sophia, oder der Anfang aller Geschichten
Rafik Schami: Sophia, oder der Anfang aller GeschichtenRafik Schami: Die geheime Mission des Kardinals
Rafik Schami: Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte Oder wie ich zum Erzähler wurde
Rafik Schami: Der ehrliche Lügner Roman von tausendundeiner Lüge
Die Bücher von Rafik Schami interessieren mich zum Einen, weil sie mir helfen die arabischen Länder und ihre Kultur besser zu verstehen. Zum Anderen fasziniert er mich als ein Mensch, der erfolgreich den Wechsel in eine andere Kultur geschaft und literarisch verarbeitet hat.
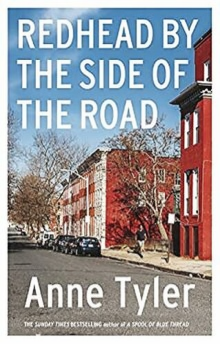 Anne Tyler: Redhead by the Side of the Road
Anne Tyler: Redhead by the Side of the RoadAngeblich ein Liebesroman. Normalerweise lese ich keine Liebesromane. Dieser ist aber einzigartig, so dass sogar ich ihn lesen kann.
← Diese Ausgabe des Buches gibt es anscheinend nur noch antiquarisch.
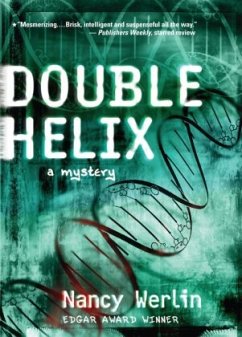
 Nancy Werlin: Double Helix auf englisch
Nancy Werlin: Double Helix auf englischNancy Werlin: Double Helix auf deutsch (erschien auf deutsch auch unter dem Titel Chromosom 4)
Hier zitiere ich 'mal wieder den Text einer früheren Buchbesprechung von buecher.de:
‚‚Double Helix erzählt die Geschichte von Eli Samuels, der nach seiner Schulzeit eine Stelle am Labor für Molekularbiologie des renommierten Dr. Quincy Wyatt erhält. Aber warum will Elis Vater partout nicht, dass er dort arbeitet? Welche seltsame Verbindung besteht zwischen seinen Eltern und dem skrupellosen Dr. Wyatt? Und wer genau ist die rätselhafte Kayla, die ihm so vertraut scheint? Elis Mutter leidet inzwischen an einer vererblichen Erkrankung des Nervensystems im fortgeschrittenen Stadium, doch sein Vater bleibt Eli jede Erklärung schuldig. Schließlich muss er sich selbst auf die Suche nach Antworten begeben, um dabei herauszufinden, wer er in Wirklichkeit ist.’’
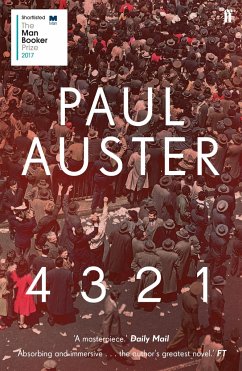
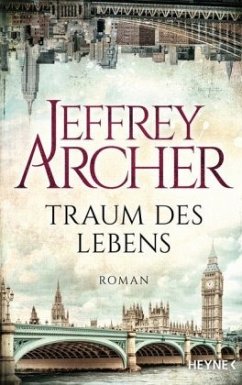 Paul Auster: 4 3 2 1
Paul Auster: 4 3 2 1Jeffrey Archer: Traum des Lebens
Die beiden Bücher haben gemeinsam, dass sie nicht nur eine Version sondern mehrere Versionen der Geschichte erzählen.
Paul Auster erzählt die Geschichte seines Helden Archibald Ferguson in vier verschiedenen Varianten. Archibald Ferguson wächst im Amerika der Fünfziger- und Sechzigerjahre auf. Es geht um Protest gegen den Vietnamkrieg, Studentenrevolte und Rassenunruhen. Es ist nicht nur so, dass jeder der vier Abschnitte eine andere Variante schildert, wie das Leben des Archibald Ferguson hätte verlaufen können. Jede Variante bringt auch andere Einblicke in das Leben in den USA in den Fünfziger- und Sechziger-Jahren. Spannend.
Jeffrey Archers Romanhandlung beginnt im Jahre 1968: Am Hafen von Leningrad müssen der junge Alexander Karpenko und seine Mutter auf der Flucht vor dem KGB entscheiden, auf welches Schiff sie sich als blinde Passagiere schleichen. Ein Schiff fährt nach Großbritannien, das andere in die in die USA. Der Wurf einer Münze soll entscheiden, wo es hingeht. Tatsächlich schildert das Buch auf faszinierende Weise beide Versionen der gelungenen Flucht: Von der nach London und von der nach New York.
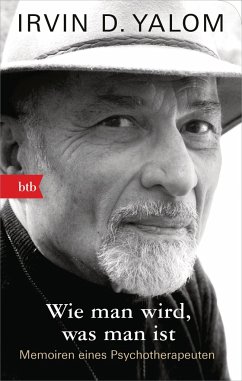 Irvin D. Yalom: Wie man wird, was man ist Memoiren eines Psychotherapeuten
Irvin D. Yalom: Wie man wird, was man ist Memoiren eines PsychotherapeutenFür mich als jemand, der in der Psychiatrie arbeitet, eine Pflichtlektüre, die man nicht als Pflicht erlebt.
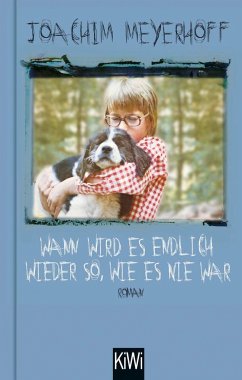 Joachim Meyerhoff: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war Alle Toten fliegen hoch, Teil 2 (von 5)
Joachim Meyerhoff: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war Alle Toten fliegen hoch, Teil 2 (von 5)Hier übernehme ich einmal den Text einer früheren Buchbesprechung von www.buecher.de: „Ein brüllend komischer und tieftrauriger Roman über einen Jungen, der als Sohn des Direktors einer Kinder- und Jugendpsychiatrie am besten schläft, wenn nachts die Schreie der Patienten hallen, der Blutsbrüderschaft mit dem Hund schließt und dem Doppelleben seines Vaters auf die Spur kommt - einem faszinierenden Mann, der in der Theorie glänzt, in der Praxis versagt, voller Lebensfreude ist und doch nichts gegen sein viel zu frühes Ende tun kann.”
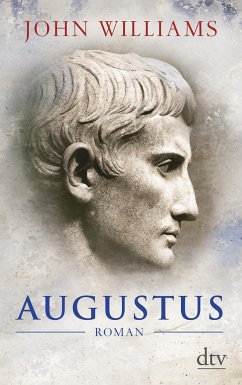 John Williams: Augustus
John Williams: AugustusOctavius, Großneffe und Adoptivsohn von Julius Caesar, späterer Kaiser Augustus. Der Autor schildert das Leben von Augustus so, dass wir ganz viel über das Leben in der Antike erfahren und dabei Emotionen und was die Menschen damals antrieb, plastisch und nachvollziehbar wird.
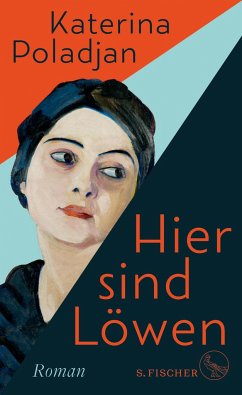 Katerina Poladjan: Hier sind Löwen,
Eine Buch-Restauratorin erhält den Auftrag die Familienbibel
einer
armenischen Familie zu restaurieren. Die Restauratorin beginnt vor
Ort in Armenien Nachforschungen anzustellen und erfährt dabei
Entscheidendes über ihre eigene aus Armenien stammende
Familie.
Katerina Poladjan: Hier sind Löwen,
Eine Buch-Restauratorin erhält den Auftrag die Familienbibel
einer
armenischen Familie zu restaurieren. Die Restauratorin beginnt vor
Ort in Armenien Nachforschungen anzustellen und erfährt dabei
Entscheidendes über ihre eigene aus Armenien stammende
Familie.
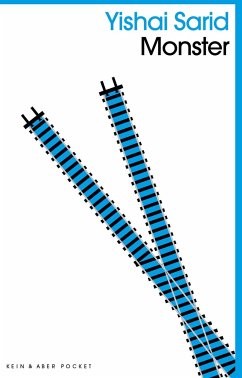 Yishai Sarid: Monster
Yishai Sarid: Monster"Ein israelischer Tourguide streckt im Konzentrationslager von Treblinka einen deutschen Dokumentarfilmer mit einem Faustschlag nieder." Das Buch hat mir klargemacht, dass das Andenken an den Holocaust für Juden heutzutage genauso eine Herausforderung ist, wie für uns, die Nachfahren der Täter.
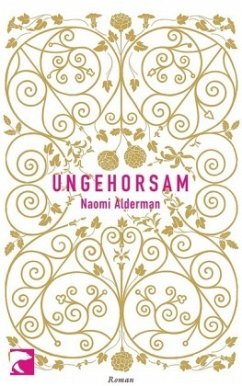
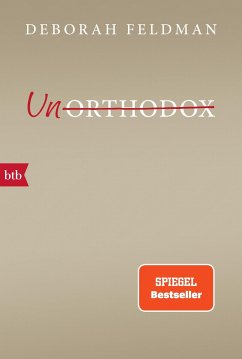
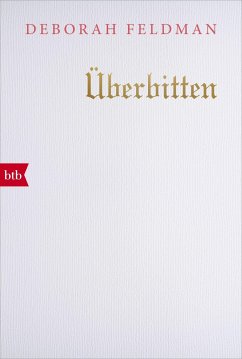 Naomi Alderman: Ungehorsam
Naomi Alderman: UngehorsamDeborah Feldman: Unorthodox
Deborah Feldman: Überbitten
Das erste der drei Bücher handelt von einer Rückkehr: Die Ich-Erzählerin kommt aus New York. Nach dem Tod ihres Vaters kehrt sie nach London, in die orthodoxe jüdische Gemeinschaft zurück, der ihr Vater vormals als Rabbi vorstand. Das zweite beschreibt das Leben von Deborah Feidman in einer solchen orthodoxen jüdischen Gemeinschaft und das dritte Buch beschreibt, wie Deborah Feidman die orthodoxe jüdische Gemeinschaft verlässt und am Ende in Berlin ein neues Leben beginnt.
Albrecht Mälzer